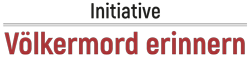Rede zum Gedenken an den Völkermord an den Armeniern 1915
Auch am 24. April diesen Jahres versammelten sich über hundert Menschen am Mahnmal „Dieser Schmerz betrifft uns alle“, um der Opfer des Genozids an den Armeniern zu erinnern, der vor 110 Jahren im damaligen Osmanischen Reich begann. Der Komitas-Chor der Armenischen Gemeinde rahmte die Feierstunde mit Liedern ein, Gemeindepfarrer Hayr Yeghishe Avetisyan begann mit einer Andacht, danach wurden Beiträge von Atranik Tabaker, Talin Kalatas und Wolfgang Heiermann vorgetragen:
***
„In den sozialen Medien gibt es derzeit ein Reel, das oft geteilt und nachgestellt wird:
Zu sehen sind 3 Wassergläser, zwei leere ein volles. In dem vollen ist verschmutztes Wasser, das in eines der leeren Gläser gekippt wird und von diesem in das andere Leere.
Das letzte Glas wird dann solange mit klarem Wasser gespült, bis nichts von dem schmutzigen Wasser übrigbleibt.
Darüber in großen Buchstaben „generationales Trauma kannst du selbst stoppen“. – oder so etwas in der Art.
Was uns Social Media damit sagen möchte ist: optimiere dich selbst, DU kannst dafür sorgen, dass Traumata nicht weiter vererbt werden, wenn du nur gut genug an dir arbeitest, werden deine Kinder die Traumata der letzten Generationen nicht weiterleben.
Unabhängig davon, dass das überhaupt nicht so einfach ist und Menschen keine Gläser, die mit klarem Wasser gespült werden können, bis sie sauber sind – Was soll eigentlich dieses klare Wasser hier bedeuten? Fehlen neben den Traumata die in unseren Familiengeschichten stecken auch die guten Erinnerungen?Oder die Willenskraft von vorne beginnen zu können, nachdem man das unvorstellbare erlebt hat? Sind wir nicht funktional, wertig und besonders, wenn unser Wasser durch das Leid unserer Geliebten „getrübt“ wurde? Oder ist das klare Wasser im Kontext des Völkermords vielleicht sogar das Übernehmen der Nationalgeschichte der Täter*innen und damit die Aufgabe unserer eigenen Geschichte?
Die Metapher der Gläser mit schmutzigem Wasser als generationale Traumata ist also nicht nur schlecht und unsinnig, sie ist auch höchst gefährlich.
Natürlich ist es möglich und sinnig durch professionelle Hilfe einen Umgang mit dem eigenen generationalen Trauma zu finden. Das ist aber keine Selbstoptimierung, das ist Heilung. Aber ein Trauma, das muss aber auch gesehen und anerkannt werden, damit eine Chance besteht heilen zu können.
Ein tiefgreifendes generationales Trauma, wie das des Völkermords an den Armenier*innen bezieht sich nicht nur auf Ermordung, mit ihm gehen auch sexualisierte Gewalt, kulturelle Auslöschung, Identitätsverlust und Selbstverleugnung durch Assimilation und das Trauma des Leugnens der Täter*innen und ihrer Nachfahr*innen einher.
Die systematische Leugnung des Völkermords durch die heutige Türkei, durch die türkische Mehrheitsgesellschaft in der Türkei & in der Diaspora – das Verweigern der armenischen Erinnerungskultur, wie wir es hier in Köln jahrelang im Streit um das Mahnmal erlebt haben – oder auch das internationale Ignorieren der ethnischen Säuberung Artsakhs – lässt gar keine Möglichkeit entstehen, in der sich die unbegreiflich tiefe Wunde des Völkermords überhaupt schließen kann. Wie soll sie dann erst heilen?
Wir leben in einem Land, indem uns Nachfahr*innen der Überlebenden durch eine Resolution versprochen wurde unsere Geschichte anzuerkennen, darüber zu lehren, uns zu schützen. Dies geschieht nicht.
Während der ethnischen Säuberung Artsakhs beispielsweise hatte die Mehrheitsgesellschaft die Chance an unserer Seite zu stehen, einen Teil unserer Last zu tragen und in der Anerkennung unseres Leids auch zu unserer Heilung beizutragen. Durch das Schweigen jedoch wurde unser Leid noch größer, die Wunde unseres Traumas noch tiefer.
Zur Aufarbeitung von Traumata gehört es anzuerkennen, zuzuhören und zu reden, die Geschichten zu erzählen. Die unserer Familien, die der anderen Familien, die derjenigen die ihre Geschichten verloren haben, aber auch von all denen die nicht mehr gehört werden können. Und es kommen neue Geschichten dazu, die von Artsakh, von Dadivank und Stepanakert, von Orten dem Himmel so nah und von unseren stolzen und wehrhaften Geschwistern und Freund*innen, die alles gaben und von der Welt alleine gelassen wurden.
Wir schulden es ihnen und unseren Vorfahr*innen zu fühlen, zu lachen, zu lieben und zu leben. Und zum Leben gehört auch um ihretwegen zu trauern, um unsere Liebe für sie am Leben zu erhalten.
Unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern waren keine Gläser schmutzigen Wassers. Sie waren Überlebende, sie haben Leben geschaffen und unsere Identitäten am Leben gehalten. Sie waren mutig, sie waren ängstlich, sie waren traurig und fröhlich. Sie waren, sie sind Menschen. Und sie haben alles gegeben, dass wir ein besseres Leben führen können als sie.
Und ja, auch wir sind voller generationaler Traumata, aber auch wir sind kein Glas voller schmutzigem Wasser.
Wir sind voller Lebenswillen und Widerstandsfähigkeit, voller Liebe und Stolz.
Wir sind die, die all diejenigen am Leben halten, die von der Welt vergessen wurden und damit die Nachfahr*innen der Täter*innen stetig an unsere Existenz erinnern.
Wir sind die, die unseren Schmerz teilen und gemeinsam heilen. Wir sind die, die ihre Versprechen nicht brechen.“
Köln, 24.04.2025
Rede des Vorsitzenden der armenischen Gemeinde in Köln, Antranik Tabaker, zum Gedenken an den Völkermord an den Armeniern 1915
Auch am 24. April diesen Jahres versammelten sich über hundert Menschen am Mahnmal „Dieser Schmerz betrifft uns alle“, um der Opfer des Genozids an den Armeniern zu erinnern, der vor 110 Jahren im damaligen Osmanischen Reich begann. Der Komitas-Chor der Armenischen Gemeinde rahmte die Feierstunde mit Liedern ein, Gemeindepfarrer Hayr Yeghishe Avetisyan begann mit einer Andacht, danach wurden Beiträge von Atranik Tabaker, Talin Kalatas und Wolfgang Heiermann vorgetragen:
***
„In den sozialen Medien gibt es derzeit ein Reel, das oft geteilt und nachgestellt wird:
Zu sehen sind 3 Wassergläser, zwei leere ein volles. In dem vollen ist verschmutztes Wasser, das in eines der leeren Gläser gekippt wird und von diesem in das andere Leere.
Das letzte Glas wird dann solange mit klarem Wasser gespült, bis nichts von dem schmutzigen Wasser übrigbleibt.
Darüber in großen Buchstaben „generationales Trauma kannst du selbst stoppen“. – oder so etwas in der Art.
Was uns Social Media damit sagen möchte ist: optimiere dich selbst, DU kannst dafür sorgen, dass Traumata nicht weiter vererbt werden, wenn du nur gut genug an dir arbeitest, werden deine Kinder die Traumata der letzten Generationen nicht weiterleben.
Unabhängig davon, dass das überhaupt nicht so einfach ist und Menschen keine Gläser, die mit klarem Wasser gespült werden können, bis sie sauber sind – Was soll eigentlich dieses klare Wasser hier bedeuten? Fehlen neben den Traumata die in unseren Familiengeschichten stecken auch die guten Erinnerungen?Oder die Willenskraft von vorne beginnen zu können, nachdem man das unvorstellbare erlebt hat? Sind wir nicht funktional, wertig und besonders, wenn unser Wasser durch das Leid unserer Geliebten „getrübt“ wurde? Oder ist das klare Wasser im Kontext des Völkermords vielleicht sogar das Übernehmen der Nationalgeschichte der Täter*innen und damit die Aufgabe unserer eigenen Geschichte?
Die Metapher der Gläser mit schmutzigem Wasser als generationale Traumata ist also nicht nur schlecht und unsinnig, sie ist auch höchst gefährlich.
Natürlich ist es möglich und sinnig durch professionelle Hilfe einen Umgang mit dem eigenen generationalen Trauma zu finden. Das ist aber keine Selbstoptimierung, das ist Heilung. Aber ein Trauma, das muss aber auch gesehen und anerkannt werden, damit eine Chance besteht heilen zu können.
Ein tiefgreifendes generationales Trauma, wie das des Völkermords an den Armenier*innen bezieht sich nicht nur auf Ermordung, mit ihm gehen auch sexualisierte Gewalt, kulturelle Auslöschung, Identitätsverlust und Selbstverleugnung durch Assimilation und das Trauma des Leugnens der Täter*innen und ihrer Nachfahr*innen einher.
Die systematische Leugnung des Völkermords durch die heutige Türkei, durch die türkische Mehrheitsgesellschaft in der Türkei & in der Diaspora – das Verweigern der armenischen Erinnerungskultur, wie wir es hier in Köln jahrelang im Streit um das Mahnmal erlebt haben – oder auch das internationale Ignorieren der ethnischen Säuberung Artsakhs – lässt gar keine Möglichkeit entstehen, in der sich die unbegreiflich tiefe Wunde des Völkermords überhaupt schließen kann. Wie soll sie dann erst heilen?
Wir leben in einem Land, indem uns Nachfahr*innen der Überlebenden durch eine Resolution versprochen wurde unsere Geschichte anzuerkennen, darüber zu lehren, uns zu schützen. Dies geschieht nicht.
Während der ethnischen Säuberung Artsakhs beispielsweise hatte die Mehrheitsgesellschaft die Chance an unserer Seite zu stehen, einen Teil unserer Last zu tragen und in der Anerkennung unseres Leids auch zu unserer Heilung beizutragen. Durch das Schweigen jedoch wurde unser Leid noch größer, die Wunde unseres Traumas noch tiefer.
Zur Aufarbeitung von Traumata gehört es anzuerkennen, zuzuhören und zu reden, die Geschichten zu erzählen. Die unserer Familien, die der anderen Familien, die derjenigen die ihre Geschichten verloren haben, aber auch von all denen die nicht mehr gehört werden können. Und es kommen neue Geschichten dazu, die von Artsakh, von Dadivank und Stepanakert, von Orten dem Himmel so nah und von unseren stolzen und wehrhaften Geschwistern und Freund*innen, die alles gaben und von der Welt alleine gelassen wurden.
Wir schulden es ihnen und unseren Vorfahr*innen zu fühlen, zu lachen, zu lieben und zu leben. Und zum Leben gehört auch um ihretwegen zu trauern, um unsere Liebe für sie am Leben zu erhalten.
Unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern waren keine Gläser schmutzigen Wassers. Sie waren Überlebende, sie haben Leben geschaffen und unsere Identitäten am Leben gehalten. Sie waren mutig, sie waren ängstlich, sie waren traurig und fröhlich. Sie waren, sie sind Menschen. Und sie haben alles gegeben, dass wir ein besseres Leben führen können als sie.
Und ja, auch wir sind voller generationaler Traumata, aber auch wir sind kein Glas voller schmutzigem Wasser.
Wir sind voller Lebenswillen und Widerstandsfähigkeit, voller Liebe und Stolz.
Wir sind die, die all diejenigen am Leben halten, die von der Welt vergessen wurden und damit die Nachfahr*innen der Täter*innen stetig an unsere Existenz erinnern.
Wir sind die, die unseren Schmerz teilen und gemeinsam heilen. Wir sind die, die ihre Versprechen nicht brechen.“
Köln, 24.04.2025