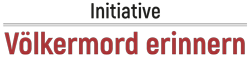Im Anschluss an eine Matinee „Völkermorde erinnern, Kriege verhindern“ am 15. April 2018 in Köln haben die Initiative „Völkermord erinnern“ und Besucherinnen und Besucher ein Mahnmal enthüllt. Es erinnert nicht nur an den Genozid an den Armeniern in den Jahren 1915-1918, sondern auch an die deutsche Beteiligung daran und fordert grundsätzlich dazu auf, Rassismus und Nationalismus als Ursachen von Völkermorden zu ächten.
Das Mahnmal ist an der linksrheinischen Seite der Hohenzollernbrücke errichtet worden, gegenüber dem Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm II., Verantwortlicher für den Völkermord an den OvaHerero und Nama 1904 und Unterstützer des Genozids an den Armeniern.
Das Genozid-Mahnmal wurde von der Stadt Köln am 19. April 2018 abgerissen. Es habe an einer Genehmigung gefehlt. Die Stadt hat in ihrem Schriftsatz gegenüber dem Verwaltungsgericht Köln, das wir angerufen hatten, außerdem argumentiert, das Mahnmal müsse noch vor dem 24. April, dem internationalen Gedenktag an den Genozid, beseitigt werden, weil sonst die Gefahr bestehe, dass sich „zahlreiche Gegendemonstranten einfinden“ und „die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs an dieser Stelle zeitnah stark beeinträchtigt“ sei. „Angesichts der Vielzahl türkischer Mitbürger in Köln“ sei auch schon 2017, bei der Erlaubnis für den Kreuzstein der armenischen Gemeinde „auf eine Aufstellung im öffentlichen Straßenland aufgrund des hohen Konfliktpotentials bewusst verzichtet worden“. Das Verwaltungsgericht Köln hat die sofortige Entfernung des Genozidmahnmals an der Hohenzollernbrücke nicht beanstandet.
In unserer Antwort beim Verwaltungsgericht hielten wir fest, dass wir diese Argumentation für ein erinnerungspolitisches Armutszeugnis und ein Ausweichen vor Genozidleugnern halten. Sie widerspricht diametral der Aufforderung des Bundestags, der in seiner Resolution vom 2. Juni 2016 die Zivilgesellschaft auffordert, das Gedenken an den armenischen Genozid zu thematisieren.
Zahlreiche Organisationen und Prominente haben sich mittlerweile als PatInnen und UnterstützerInnen für das Mahnmal und für seine Wiedererrichtung ausgesprochen.
Wir richten unsere Anstrengungen weiterhin darauf, möglichst viele zivilgesellschaftliche Kräfte in dem Bemühen zu vereinen, die Stadt Köln solle das Genozid-Mahnmal wieder aufstellen.
Das Mahnmal muss an seinen Platz zurück!
L’initiative « Rappeler le Génocide » ainsi que les visiteurs ont inauguré le 15 avril 2018 à Cologne un monument à la suite d’une matinée sur le thème « Rappeler le génocide, Empêcher les guerres ». Il rappelle non seulement le génocide commis dans les années 1915 – 1918 aux Arméniens mais également la participation allemande et exige de proscrire le racisme et le nationalisme comme la cause des génocides.
Le monument a été érigé sur le bord gauche du pont sur le Rhin, le« Hohenzollernbrücke » en face de la statue du Kaiser Wilhelm II, responsable du génocide des OvaroHerero et Nama en 1904 et soutien du génocide des Arméniens.
Le Monument a été enlevé par la ville de Cologne le 19 avril 2018, pour manque d’autorisation préalable. La ville de Cologne a également argumenté, dans le cadre d’une procédure devant le tribunal administratif de Cologne entamée par nous, que le monument devrait être enlevé avant le 24 avril 2018, jour de la commémoration internationale du génocide aux Arméniens, afin d’éviter « le rassemblement de nombreux contre-manifestants » présentant un fort risque pour « la sécurité et la facilité du trafic à cet endroit ». Au vu de la présence de nombreux citoyens turcs à Cologne, la ville aurait déjà en 2017, lors de la mise en place du « Kreuzstein » de la communauté arménienne, refusé expressément une permission de la mise en place dans le domaine public à cause du potentiel de conflit élevé.
Le tribunal administratif de Cologne n’a pas contesté l’enlèvement immédiat du monument du génocide près de la «Hohenzollernbrücke».
Dans notre réponse au tribunal administratif nous avons souligné que nous jugeons cette argumentation comme insulte à une politique de mémorisation et un recul devant ceux qui nient le génocide. Elle contredit diamétralement la demande du Bundestag qui dans sa résolution du 2 juin 2016 demande à la société civile de thématiser la mémoire du génocide aux Arméniens.
Un grand nombre d’organisations et de personnes importantes de la vie culturelle et intellectuelle se sont déclarées parrain ou soutien pour le monument et sa réinstallation.
Nos efforts continuent afin qu’un grand nombre de personnes de la vie civile se réunisse pour exiger de la ville de Cologne la réinstallation du monument du génocide.
LE MONUMENT DOIT RETOURNER A SA PLACE!
Presseerklärung 15.4. 2018 – Initiative Völkermord erinnern
Presseerklärung 15.4. 2018 – Initiative Völkermord erinnern
Völkermord-Mahnmal errichtet!
Im Anschluss an die Matinee „Völkermorde erinnern, Kriege verhindern“ am 15. April in Köln haben die Initiative „Völkermord erinnern“ und Besucherinnen und Besucher eine Skulptur enthüllt. Es ist das erste Mahnmal in Deutschland im öffentlichen Raum, das an den mit deutscher Beteiligung durchgeführten Genozid an den Armeniern in den Jahren 1915-1918 erinnert.
Das Mahnmal, das von den Kölner Künstlern Stefan Kaiser und Max Scholz realisiert wurde, ist an der linksrheinischen Seite der Hohenzollernbrücke errichtet worden. Es steht gegenüber dem Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm II., Verantwortlicher für den Völkermord an den Ovaherero und Nama 1904 und Unterstützer des Genozids an den Armeniern.
Bereits im vergangenen Jahr hatte die armenische Gemeinde Köln mit Unterstützung des Kölner Stadtrats auf dem Brücker Friedhof einen Kreuzstein zur Erinnerung an die Opfer des Genozids aufgestellt. Wir sehen in dem heute von uns an einem exponierten Ort in Köln aufgestellten Mahnmal eine wichtige Ergänzung der letztjährigen Initiative.
Auf der dreiseitigen stählernen Pyramide, auf deren gekappter Spitze ein seitlich geschlitzter Granatapfel aus Bronze ruht – als ein Symbol für den Genozid an den Armeniern – ist in armenisch, deutsch, türkisch und englisch die folgende Inschrift angebracht:
Dieser Schmerz betrifft uns alle
Während des 1. Weltkrieges – zwischen 1915 und 1918 – wurden in der heutigen Türkei über eine Million armenische Frauen, Männer und Kinder aus ihren Häusern vertrieben, deportiert und ermordet. Das Osmanische Reich und die beteiligten deutschen Offiziere unter Führung Kaiser Wilhelm II. tragen die Verantwortung für diesen Völkermord an der armenischen Bevölkerung.
Nur eine entschiedene Ächtung der Entwürdigung von Minderheiten und die Einsicht, dass es weder religiöse, nationale noch ethnische Überlegenheit zwischen den Menschen gibt, kann solche Verbrechen verhindern.
Die Überschrift „Dieser Schmerz betrifft uns alle“ nimmt die jährliche Erinnerungsaktion in der Kölner Partnerstadt Istanbul auf, die unter demselben Titel steht. Die Wiedererrichtung eines historischen Mahnmals im Gezi-Park in Istanbul ist von den türkischen Behörden bislang verhindert worden.
Die Initiator*innen der heutigen Aktion haben das Mahnmal den Kölner Bürger*innen und ihren gewählten Vertreter*innen geschenkt und der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker eine Schenkungsurkunde zugestellt.
Neben den Gruppen, die zur Matinee aufgerufen haben (s.u.), wird die Errichtung des Mahnmals von folgenden Personen unterstützt, die eine Patenschaft für die Skulptur übernommen haben:
– Doğan Akhanlı, Schriftsteller
– Prof. Dr. Micha Brumlik, eh. Leiter des Fritz-Bauer-Instituts Frankfurt
– Gunter Demnig, Künstler (Stolpersteine)
– Çiler Fırtına, Dolmetscherin
– Prof. Dr. Martin Pätzold, Mitglied des Bundestages 2013-2017
– Dr. Martin Stankowski, Stadthistoriker
– Günter Wallraff, Journalist
– Ragıp Zarakolu, Menschenrechtsaktivist
Auf unser Website www.voelkermord-erinnern.de finden Sie Fotos zur Ihrer Verfügung.
Initiative Völkermord Erinnern; recherche international e.V., FilmInitiativ Köln e.V., Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V., Kulturforum TürkeiDeutschland e.V., Jugendclub Courage e.V., Anerkennung Jetzt!
Wir bitten freundlich um Berichterstattung.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an .
Rede Peter Finkelgruen: 11 Jahre Geschichtserinnerung
Matinee-Rede von Peter Finkelgruen
Vor wenigen Tagen wurde der Seder-Abend begangen. Es ist der erste Abend des siebentägigen Pessah Festes. Auch wenn ich kein religiöser Mensch bin, so nehme ich doch gern an der Feier dieses Festes teil. Das liegt nicht zuletzt an einem Satz. Es ist ein Satz der über Erinnerung spricht und die Bedeutung die geschichtliche Erinnerung für den Menschen hat. Der Satz lautet:
„In jeder Generation sollte jeder Mensch sich betrachten, als ob er ganz persönlich aus Ägypten befreit worden wäre.“
Als ich im Jahr 1988 nach einem knappen Jahrzehnt der Arbeit in Jerusalem nach Deutschland zurückgekehrt bin ahnte ich nicht daß mir mehr als ein Jahrzehnt bevorstand in dem ich mich einer permanenten Konfrontation ausgesetzt sehen würde. Einer Konfrontation mit der Justiz dieses Landes. Einem Jahrzehnt daß eine einzige tägliche Erinnerung an die Geschichte dieses Landes und an die Untaten. die im Dritten Reich begangen wurden war. Das ich elf Jahre lang mich in die Geschichte vertiefen müste um in der Lage zu sein den Mann, der meinen Grossvater in der kleinen Festung Theresienstadt erschlagen hat, vor die Schranken eines Gerichts in der Bundesrepublik Deutschland zu bringen.
Während meiner Jahre in Israel erhielt ich Fotokopien von Briefen die meine Eltern auf ihrer Flucht vor den NS Schergen geschrieben haben. Es waren knapp dreißig lange und ausführliche zumeist Schreibmaschinengeschriebene Briefe. Sie wurden auf der Flucht aus Prag, ihrer letzten Station in Europa, in die Emigration nach Shanghai in China und von dort selbst geschrieben.
Schon vor der Rückkehr nach Deutschland hatte ich die Absicht gefasst diese Brief zu nutzen wie einen Reiseführer und die Reiseroute nach zu reisen. Meine Frau und ich beschlossen, diese Reise in Etappen zu absolvieren und fuhren nach Prag, der ersten Station der Reise. Mein Vater stammte aus Bamberg, meine Mutter aus Karlsbad. Sie heirateten in Prag. Dort began ihre Emigrationsreise, die sie bis nach Shanghai führen sollte. In Prag lebte meine Großmutter mütterlicherseits und mein Großvater väterlicherseits Sie war Christin. Er war Jude. Sie versteckte ihn in ihrer Wohnung.
Die nationalsozialistische Verfolgung der Juden erreichte schließlich aber auch Shanghai, wo die japanischen Verbündeten des Deutschen Reichs auf dessen Fordern und Drängen ein Getto für die circa 30 000 Flüchlinge erichtet haben. Dort wurde ich geboren. Meine Eltern waren von Nachrichten über ihre Eltern abgeschnitten. Mein Vater starb im im gleichenJahr. Eine Folge der miserablen hygienischen und medizinischen Verhältnissen. Ich überlebte mit meiner Mutter.
Nach dem Krieg und der Befreiung durch die Amerikaner erfuhr meine Mutter daß ihre Mutter Jahre der Haft in Konzentrationslagern überlebt hatte und daß ihr Schwiegervater, mein Großvater väterlicherseits, Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung wurde.
Diese elf Jahre der Konfrontation begannen für mich im Februar 1989, in dem Moment in dem eine Freundin meiner Großmutter, die ich in Prag besuchte, mir unter Tränen erzählte wie und von wem mein Großvater in der kleinen Festung Theresienstadt ermordet wurde. Meine Großmutter hatte mir, ehe sie selbst verstarb, oft erzählt daß mein Großvater nach ihrer gemeinsamen Verhaftung durch die Gestapo in der kleinen Festung Theresienstadt, einem Gefängnis der Gestapo Prag, gestorben war. Sie hatte mir aber nicht erzählt wie er zuTode kam, geschweige denn daß sie den Namen des Mörders genannt hätte. Sie kannte ihn nicht.
Ich hatte den Namen allerdings wenige Monate vor meinem Besuch in Prag in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Eine kleine Nachrichtennotiz auf Seite 5 unten besagte daß der 1949 in der CSSR als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilte Anton Malloth von Italien in die Bundesrepublik abgeschoben worden sei. Die zuständige Statsanwaltschaft in Dortmung habe erklärt daß sie kein Interesse an der Auslieferung gehabt habe da „kein dringender Tatverdacht“ gegeben sei. Diese Meldung entsprach der Beiläufigkeit, die bei der Verfolgung von NS Verbrechen in den achtziger Jahren – und davor – in der Bundesrepublik zur Regel geworden war.
Auf der Rückfahrt von Prag und Theresienstadt wohin wir nach dem Besuch bei der neunzig Jahre alten Freundin meine Großvater fuhren, wurde uns war klar dass das Projekt der Reise entlang der Fluchtroute meiner Eltern, nun ad acta gelegt werden musste. Ich musste entscheiden wie ich auf die Nachricht die ich erhalten habe und auf das Wissen um den Mörder meines Großvater reagieren sollte. Ich kann nicht verleugnen, daß ich durchaus attavistische Regungen verspürte und unterschiedlichste Rachephantasien gehabt habe. Sie entwickelten sich entlang eine ganzen Skala von physischer Konfrontation und dem Einsatz meine Fäuste bis zur Handfhabung einer Pistole, die ich mir nachts am Kölner Hauptbahnhof besorgen würde – das Darknet gab es damals noch nicht -. Nur wenige Jahre später kam eine weitere Variante hinzu. Mit Freunden wurden dreimal Pläne entwickelt, den Mörder der die Jahre nach seiner Ausweisung in die Bundesrepublik in München Pullach in einem Altersheim in direkten Nachbarschaft zum BND lebte, zu entführen und bei der Polizei in Theresienstadt sozusagen abzuliefern.
Durchgesetzt hat sich keine dieser Phantasien. Durchgesetzt hat sich die Überzeugung, dass es richtig und notwendig sei den Rechtstaat Bundesrepublik herauszufordern und das Recht durchzusetzen. Die naive Vorstellung es müße eine Selbstverständlichkeit sein daß in diesem Land ein Mörder angeklägt und seine Tat vor Gericht öffentlich verhandelt wird.
Ich kann nicht sagen ob ich diese Entscheidung damals so getroffen hätte wenn ich gewusst hätte, daß es elf Jahre Arbeit, Geld und des vollen Einsatzes aller Möglichkeiten bedürfen würde um das Ziel zu erreichen.
Obwohl – meine bisherigen Erfahrungen in und mit der Bundesrepublik Deutschland, bei Fragen der Verfolgung von NS-Verbrechen und ihr Umgang mit der Ära des Nationalsozialismus hätten mir eine Warnung sein können.
Mein Engagement in Sachen Edelweispiraten in Köln. Die Konfrontation mit der Hartleibigkeit der Behörden, die Jahre brauchten, um den Widerstandscharakter der Edelweispiraten anzuerkennen Sie haben im Gegensatz zum größten Teil der bürgerlichen Gesellschaft dieser Stadt einen Beitrag zu Rettung der Ehre dieser Stadt geleistet.
Ich habe bei Yad Vashem in Jerusalem den Antrag gestellt drei Personen aus dem Umkreis der Edelweispiraten als Gerechte unter den Völkern anzuerkennen. Eingereicht habe ich von mir gesammelte Unterlagen über das Verstecken mehrerer jüdischer Personen durch die Edelweispiraten. Allerding durfte ich erleben daß der Kölner Oberbürgermeister vor dem Rat der Patenstadt Tel-Aviv ein Rede hielt in der er die Edelweispiraten als eine kriminelle Gang charakterisierte.
Natürlich wußte ich auch um die Erfahrungen des Frankfurter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer was die Unzuverlässigkeit der Justiz, NS Verbrecher ihrem gerechten Urteil zuzuführen anging.
Es waren Jahrzehnte der frühen Bundesrepublik, die von Namen wie Globke, dem Kommentator der Nürnberger Gesetze und unter dem Kanzler Adenauer Chef des Kanzleramtes, Bundesministern wie Oberländer der an Kriegsverbrechen in Lemberg beteiligt war geprägt war. Die Liste der Namen ehemaliger Kriegsverbrecher im öffentlichen Dienst und an Schaltstellen des öffentlichen Lebens, ließe sich beliebig fortsetzen.
Die Grundlage dieses dunklen Kapitels der frühen Bundesrepublik war wohl ein Artikel des Grundgesetzes diese Landes. Es war der Artikel 131 dieses Gesetzes mit Verfassungsrang. Er lautet:
Die Rechtsverhältnisse von Personen einschließlich der Flüchtlinge und Vertriebenen, die am 8. Mai 1945 im öffentlichen Dienste standen, aus anderen als beamten- oder tarifrechtlichen Gründen ausgeschieden sind und bisher nicht oder nicht ihrer früheren Stellung entsprechend verwendet werden, sind durch Bundesgesetz zu regeln. Entsprechendes gilt für Personen einschließlich der Flüchtlinge und Vertriebenen, die am 8. Mai 1945 versorgungsberechtigt waren und aus anderen als beamten- oder tarifrechtlichen Gründen keine oder keine entsprechende Versorgung mehr erhalten.
Mit einfachen Worten: allen, die Beamte und Funktionsträger des Staates unter den Nationalsozialisten waren, wurden ihre Rechte, ihre Stellung und ihre Pensionen garantiert.
All das wissend habe ich mich daran gemacht die Justiz dieses Staates herauszufordern und zu verlangen daß der Mörder meine Großvaters für seine Taten vor Gericht gestellt wird. Wenn ich das alles so bedenke, klingt es ein wenig nach naiver Allmachtsphantasie. Bewusst war ich mir dessen damals so nicht.
In den Jahren die folgten musste ich alle meine Fähigkeiten und Kenntnisse, die mein Beruf als Journalist, meine Erfahrungen in der deutschen Politik und meine Kontakte permanent mobilisieren und einsetzen. Von den finanziellen Kosten ganz zu schweigen.
Das ich bei meinen Bemühungen auch in Visier der Stillen Hilfe geraten würde, habe ich damals auch nicht gewusst. Die Stille Hilfe ist eine Organisation, die sich für Anton Malloth gleich nach seiner Ankunft in München nach der Ausweisung aus Italien einsetzte.
Anton Malloth wurde geholfen. Gudrun Burwitz nahm sich höchstpersönlich seiner Sache an. Die Tochter Heinrich Himmlers, eine Art grauer Eminenz der rechten Szene in Deutschland, sorgte dafür, dass Anton Malloth in ein komfortables Altersheim umziehen konnte und dort jahrelang unbehelligt blieb – die Kosten für die Unterbringung übernahm das Sozialamt der Stadt München. Zur gleichen Zeit war dieser Sozialhilfeempfänger Besitzers eines beachtlichen Hauses in Meran. Gudrun Burwitz war eine der tragenden Säulen der „Stillen Hilfe für Internierte und Kriegsgefangene“, einem Verein, der jahrzehntelang aufgrund von Gemeinnützigkeit keine Steuern bezahlen musste. Einem Verein, der nicht nur als die erste Neonaziorganisation in der Bundesrepublik gelten kann, sondern der auch das Netz der braunen Kameraden nach dem Krieg weiter wob und eine ungebrochene Kontinuität bewirkte, auf der die rechte Szene heute aufbauen kann.
Der Leiter der Kreisverwaltung München bei der sich die Stille Hilfe erfolgreich für Anton Malloth einsetzte war
Hans-Peter Uhl. Er war von 1987 bis 1998 als Kreisverwaltungsreferent Leiter der Sicherheits- und Ordnungsbehörde der Landeshauptstadt München. Er war der Verantwortliche dafür dass Anton Malloth auf Kosten des Sozialamtes einen Platz im dem Altersheim in Pullach bekam. Er war auch verantwortlich dafür daß Anton Malloth deutche Personalpapiere ausgestellt bekam – und das obwohl Anton Malloth in Italien die deutsche Staatsbürgerschaft amtlich und nachweislich aufgegeben hat. Diese Tatsache, die Ausstellung deutscher Personalpapiere, sollte sich im kommenden Jahrzehnt als wirksamer Schutz vor rechtlicher Verfolgung des Anton Malloth erweisen. Die tschechische Regierung konnte ihre Forderung nach Auslieferung des Anton Malloth nicht durchsetzen, da das deutsche Grundgesetz die Auslieferung deutscher Staatsbürger verbietet.
Hans Peter Uhl wurde 1998 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er wurde innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Justitiar seiner Fraktion. Bei ihm musste ich immer an das Sprichwort vom Bock als Gärtner denken.
Unter dem Schutz den die Kreisverwaltung München dem Mörder meines Großvater angedeihen ließ brauchte Anton Malloth auch die Ermittlungen der Zentrallstelle im Lande Nordrhein-Westfalen für die Bearbeitung von national-sozialistischen Massenverbrechen bei der Staatsanwaltschaft Dortmund, nicht zu fürchten. Schließlich hatte diese Dienststelle der NRW Justiz den Komplex Kleine Festung Theresienstadt ja bereits lange Zeit bearbeitet. Bereits im ersten und zweiten Jahr meiner Bemühungen erhielt ich Zugang zu diesen Ermittlungsakten. Für mich war das wichtigste Dokument aus diesem Ermittlungsverfahren eine Art Zusammenfassung die der Staatsanwaltschaft Dortmund dazu diente das Verfahren gegen Anton Malloth immer wieder einzustellen. Es war eine 248 Seiten lange Zusammenfassung der ermittelten Verbrechen in diesem Gestapogefängnis und eine Zuordnung von Opfern und Tätern. Da waren 146 verdächtige Täter und 764 Fälle von Mord aufgeführt. Dieser Komplex „Straftaten im Gestapogefägnis Kleine Festung Theresienstadt„ wurde über 25 Jahre , also ein Vierteljahrhundert ermittelt ohne daß eine einzige Anklage geschweige denn Verurteilung folgte.
Meine Aufgabe und meine Anstrengungen in den ganzen Jahren war nun, die wiederholten Bemühungen der Staatsanwaltschaft das Verfahren einzustellen, zu verhindern. Zu verhindern daß der Mord an meinem Großvater „zu den Akten“ gelegt wurde, der Mörder weiter seine Unterstützung im Altersheim in München genießen konnte.
Ich mußte mit Hilfe befreundeter Juristen. Journalisten und Künstlern immer wieder die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erringen und auf den Fall lenken. Ich schrieb zahllose Artikel, und zwei Bücher die Aufmerksamkeit erhielten. Der Filmemacher Dietrich Schubert drehte zwei Dokumentarfilme zum Thema die im deutsche Fernsehen gezeigt wurden. Der Bühnenautor Joshua Sobol, schrieb ein Theaterstück mit dem Titel „Schöner Toni“ – das war der Spitzname von Anton Malloth in Theresienstadt. Es wurde im Schauspielhaus Düsseldorf in Anwesenheit des damaligen Ministerpräsidenten Rau uraufgeführt, und es wurde in Jerusalem, in Wien und in der Schweiz nachgespielt.Der Leiter des Simon Wiesenthal Zentrums in Jerusalem engagierte sich in dem Fall.
Die Reaktion des zuständigen Staatsanwalts bei einer Gelegenheit war nicht eine Anklage gegen Anton Malloth zu erheben – sondern eine Klage gegen Ralph Giordano zu einzureichen. Dieser hatte den Staatsanwalt in einer Rezension meins Buches „Haus Deutschland“ einen „emotionslosen Ochsenfrosch“ genannt. Seine Klage hatte der Dortmunder Staatsanwalt allerding fünf Minuten nach Eröffnung des Verfahren vor dem Frankfurter Gericht zurückgezogen. Bekanntgegeben wurde dies zur gleichen Zeit vom damaligen NRW Justizminister Krumsiek im Landtag in Düsseldorf. Abgeordnete, besonders die damalige Abgeordnete Brigitte Schuman der Grünen hatte sich in zahlreichen Anfragen an die Landesregierung mit Unterstützung ihre Fraktion vehement in der Sache engagiert. Auch Bundestagsabgeordnete haben sich in diesem Fall engagiert und an die auf einander folgenden Bundesjustizminister gewandt. Erwähnen will ich zwei. Den Abgeordneten Christian Ströbele und den damaligen Abgeordneten Guido Westerwelle. Es waren aber nicht nur die Legislativen in Düsseldorf und in Bonn die ich mit der Sache befasste. Im Landtag von Bayern kam es zu Anfragen. Auch im Ausland gab es Zeitungs- und Fernsehberichte. Es folgten Verlautbarungen Stellungnahme der Regierungen in Prag und Wien. Kurz vor dem Ende der Affäre hat die bayerische Landesregierung einen Emisär nach Rom geschickt der die italienische Regierung bewegen sollte die Bestätigung der Staatenlosigkeit Malloths ungeschehen zu machen. Er hatte keinen Erfolg. Ich überreichte zu der Zeit in Prag der dortigen Regierung ein juristischen Gutachten daß die Staatenlosigkeit Anton Malloths belegte und feststellte. Prag konnte nun seine Auslieferung aus Bayern verlangen. Kurz ehe die Entscheidung des damaligen bayrischen Ministerpräsidenten als Kanzlerkandidat ins Rennen zu gehen, bekannt wurde, erfolgte die Festnahme Anton Malloth in dem Altersheim in München Pullach und die Anklage vor dem München Strafgericht, der die Verhandlung und die Verurteilung des Mörders meines Großvaters folgte.
Rede zur Enthüllung des Kölner Mahnmals »Dieser Schmerz betrifft uns alle«
Rede zur Enthüllung des Kölner Mahnmals »Dieser Schmerz betrifft uns alle«
Köln, 15. April 2018
Das Mahnmal, das gerade von unseren Gästen der Matinee enthüllt worden ist, hat folgende Inschrift in deutscher, armenischer, türkischer und englischer Sprache:
Dieser Schmerz betrifft uns alle
Während des 1. Weltkrieges – zwischen 1915 und 1918 –
wurden in der heutigen Türkei über eine Million armenische
Frauen, Männer und Kinder aus ihren Häusern vertrieben,
deportiert und ermordet. Das Osmanische Reich
und die beteiligten deutschen Offiziere unter Führung Kaiser
Wilhelm II. tragen die Verantwortung für diesen
Völkermord an der armenischen Bevölkerung.
Nur eine entschiedene Ächtung der Entwürdigung
von Minderheiten und die Einsicht, dass es weder religiöse,
nationale noch ethnische Überlegenheit
zwischen den Menschen gibt, kann solche Verbrechen verhindern.
Das Mahnmal steht an einem besonderen Ort:
Es ist in unmittelbarer Nähe zum Reiterstandbild Kaiser Wilhelm II. errichtet worden. Dieser trägt als Staatsoberhaupt des deutschen Kaiserreichs erhebliche Mitverantwortung am Genozid an der armenischen Bevölkerung. Ihm, seinen Diplomaten und Offizieren war von Beginn an klar, dass die osmanischen Verbündeten die Armenier vernichten werden. Deutsche Militärs und Diplomaten besetzten Schlüsselpositionen im militärischen und zivilen Staatsapparat des osmanischen Reiches. 1913 waren fast 800 deutsche Offiziere in Istanbul zur militärischen Aufrüstung des Bündnispartners stationiert.
In der heutigen Matinee sind wir an die grausamen Geschehnisse während der Völkermorde an den OvaHerero und Nama, den Armeniern, aber auch Hunderttausenden Aramäern/Assyrern und Pontosgriechen, den Juden Europas und den Roma und Sinti erinnert worden. Wir möchten hier nur noch an einem Beispiel die unmittelbare Beteiligung der deutschen Industrie an der Vernichtung der Armenier zeigen:
Sie wurden zehntausendfach zu Zwangsarbeiten gezwungen unter anderem beim Bau der Bagdad-Bahn, die unter deutscher Federführung stattfand. In den eingerichteten Zwangsarbeitslagern endete die Arbeit für die meisten mit dem Tod. Unter anderem die Deutsche Bank, die Philipp Holzmann AG, Krupp und Borsig verdienten ihr Geld mit diesem Projekt. Die Bagdadbahn wurde für die Deportationen der Armenier eingesetzt. Der Transport in doppelbödigen Hammelwaggons musste von den Opfern selbst bezahlt werden.
Der Deutsche Bundestag hat 2016 in seiner Resolution anerkannt, dass der Deutsche Staat am Genozid an den Armeniern beteiligt gewesen ist. Von seiner Aufforderung, sich mit diesem Verbrechen auseinander zu setzen, haben wir uns angesprochen gefühlt und das Mahnmal errichtet.
Hier in Köln sind wir mit einer besonderen kommunalpolitischen Geschichte konfrontiert: Im Frühjahr 2017 haben 44 türkische Vereine und Verbände aus Köln und Umgebung einen Protest-Brief an die Stadt Köln geschickt. Sie wenden sich darin gegen einen „Gedenkstein zur Erinnerung an den Völkermord an Armeniern im Osmanischen Reich“ auf einem Friedhof in Köln Brück, auf dem sich neben dem armenischen auch ein muslimisches Gräberfeld befindet. Diese türkischen Vereine und Verbände sehen die Friedhofsruhe gestört, wenn sie an diesem Stein vorbeigehen müssen.
Das von uns heute an diesem öffentlichen Ort aufgestellte Mahnmal verstehen wir als wichtige Ergänzung zu der letztjährigen Initiative der Armenischen Gemeinde Köln und dem inzwischen auf dem Friedhof aufgestellten Kreuzstein. Wir fühlen uns mit der türkischen Zivilgesellschaft eng verbunden, die in ihrer Community und vom türkischen Staat eine Aufarbeitung des Genozids fordert und um Verständigung bemüht ist.
Etwa ein Dutzend Intellektuelle haben sich schon bereit erklärte Pate für das heute enthüllte Mahnmal zu werden und dieses zu unterstützen. Zu ihnen zählen:
– Günter Wallraff
– Dogan Akhanli
– Gunter Demnig
– Martin Stankowski
– Prof. Dr. Micha Brumlik
– Çiler Fırtına
– Ragıp Zarakolu
– Peter Finkelgruen
– Muriel Mirak-Weissbach
– und Prof. Dr. Martin Pätzold
Dieses Mahnmal ist das erste in Deutschland welches neben der türkischen auch die deutsche Mitverantwortung beim Völkermord an den Armeniern thematisiert. Es setzt ein Zeichen. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Mahnmal für die ermordeten Homosexuellen während des Nationalsozialismus und in Sichtweite zum Deportationsweg der Kölner Sinti und Roma und dem Ma‘alot von Dani Karavan. Wir halten es auch für dringend geboten, dass ein würdiger Gedenkort in Berlin an den Völkermord an Ovaherero und Nama entsteht. Wir unterstützen nachdrücklich die Forderungen nach Entschuldigung und Entschädigung der Nachfahren der Völkermorde.
Wir wissen, dass das Erinnern an Menschheitsverbrechen künftige Gewalt und Vernichtung nicht verhindert, es ist kein Garant für ein friedliches Miteinander. Aber ohne dieses Erinnern verlieren wir unsere Menschlichkeit und Wunden können nicht heilen. Wir wollen für die Opfer einen würdigen Platz in der Geschichte. Wir wollen die Täter und Verantwortlichen solcher Verbrechen benennen und die Nachfolgestaaten zur Rechenschaft ziehen.
Heute sind hier Menschen mit unterschiedlichen Herkünften zusammen gekommen. Wir lassen uns nicht ethnisieren, nicht nationalisieren, wir wollen ein Leben ohne Rassismus, ohne Sexismus und ohne Ausbeutung. Kriege und Repression erzürnen uns, wir weigern uns mitzumachen und werden sie immer bekämpfen. Das Gedenken an die Genozide ist keine Angelegenheit der betroffenen Völker, sondern muss allen Menschen als Mahnung dienen, insbesondere aber den Tätergesellschaften. Durchbrechen wir das Verschweigen und das Leugnen.
Mit diesem Mahnmal drücken wir, die wir hier anwesend sind, unsere Verbundenheit mit den Nachfahren der Opfer aus und unterstützen vergleichbare Initiativen in unserer Partnerstadt Istanbul.
Die Initiative Völkermord Erinnern hat das Mahnmal den Kölner Bürger*innen geschenkt und der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker heute eine Schenkungsurkunde zugestellt.
Köln, 15.04.2018
Nizaqete Bislimi: Rede im Zuge der Matinee „Völkermorde erinnern – Kriege verhindern“
Rede „Gegen ein leeres Erinnern“ von Nizaqete Bislimi auf der Matinee „Völkermorde erinnern – Kriege verhindern“ am 15.4 2018 im Filmforum NRW im Museum Ludwig
Mein Ur-Großvater hat gegen die Nazis gekämpft. Ich erfuhr davon erst vor kurzem, während der Arbeit an meinem Buch. Bis dahin dachte ich, ich hätte keinen persönlichen Bezug. Meine Mutter erzählte mir während meiner Recherchen, dass ihr Großvater in Jugoslawien gegen die Nazis kämpfte und auch gefallen ist. Also mein Ur-Großvater. Meine Mutter ist in den 50er Jahren geboren, hat diesen Großvater also nicht kennengelernt.
In der Schule lernte ich sehr wenig über den Genozid. In den Geschichtsbüchern wird mit einem Halbsatz erwähnt, das Roma und Sinti ermordet worden. Ich setzte mich also sehr spät erst mit dem Thema auseinander.
Als meine Mutter davon erzählte, war das ein trauriges Gefühl, weil sie nicht und ich auch nicht die Möglichkeit hatten, diesen Menschen kennen zu lernen.
Aber es war auch berührend zu erfahren, dass dieser Mann gegen die Nazis gekämpft hat.
Oft liest man nur von den Opfern, die es gegeben hat. Mein Urgroßvater hat sein Leben gelassen, weil er gekämpft hat, gegen die Nazis. Das war schon sehr berührend.
Die Roma nennen den Genozid Porajmos, was auf deutsch so viel wie »Verschlingen« bedeutet. Wieviele Menschen das betraf und wieviele in nachfolgenden Generationen heute noch betroffen sind, ist unzureichend erforscht. Es wird angenommen, dass 500.000 Menschen ermordet wurden. Diese Zahl ist wie so viele Zahlen in der Politik bis heute umstritten.
Soziale Ausgrenzung, rassistische Diskriminierungen aber auch die zahlreichen und europaweit stattfindenden Vertreibungen, Abschiebungen und sogar Morde an Roma sind keine von einander unabhängigen Einzelereignisse. Sie stehen im Zusammenhang mit einem allgegenwärtigen feindlichen und abwertenden gesellschaftlichen Vorbehalt.
Die Verfolgung durch die Mehrheitsgesellschaft war eine Konstante. Lange vor dem Porajmos. Und auch danach. Mit vielen Abstufungen und Ausprägungen.
In den 50er und 60er Jahren haben die Menschen weitergemacht, die an der Selektion beteiligt waren. Es gab nach wie vor Nazis.
Vielen überlebenden Sinti und ihren Angehörigen wurde kurz nach der Befreiung und nach der Rückkehr aus den Lagern die zuvor aberkannte deutsche Staatsbürgerschaft wieder gegeben. Doch das wurde Anfang der 50er Jahre erneuten Prüfungen unterzogen. Zu großzügig sei man in der Vergabe von Pässen an Überlebende gewesen, fanden die Behörden nun. Dieser rassistische Geiz wirkte auch auf die Praxis der Entschädigungen.
Es dauerte Jahre, bis es zu Entschädigungszahlungen kam. Nach dem Krieg wurden Sinti und Roma von der Bundesrepublik nicht entschädigt, da die Tötungen nicht als Völkermord anerkannt wurden.
Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, hatte anlässlich eines Besuchs beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe im Herbst 2014 darauf hingewiesen, dass sich das Hohe Gericht nach all den Jahren noch immer nicht von diffamierenden Formulierungen eines BGH-Urteils aus dem Jahr 1956 distanziert hatte. Damals hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass Sinti und Roma bis 1943 nicht aus rassistischen Gründen verfolgt worden seien. Die Richter hatten damals argumentiert Sinti und Roma seien nicht aus rassistisch motivierten Gründen von den Nationalsozialisten verfolgt worden, sondern diese Handlungen hätten „polizeiliche Gründe gehabt“. Dies hatte neben der tiefen Beleidigung der Opfer außerdem die Konsequenz, dass an die Überlebenden keine Entschädigungen gezahlt werden mussten. 1963 wurde dieses Urteil revidiert. Erst der Besuch Romani Roses beim Bundesgerichtshof über 50 Jahre später bewirkte eine offizielle Distanzierung dazu.
Im Rahmen eines Besuches in Heidelberg besuchte ich die die Dauerausstellung des Dokumentationszentrums. Die Ausstellung gegen das Vergessen hat mich sehr beeindruckt. Sie ist das Ergebnis einer jahrelangen Bürgerrechtsbewegung.
Der rassistisch motivierte Porajmos wurde erst 1982 durch Bundeskanzler Helmut Schmidt anerkannt. Ausgedacht hatte er sich das nicht selbst, das war kein Geschenk. Die Roma Bürgerrechtsbewegung bestand seit Anfang der 70er Jahre auf ihre Rechte.
In den 60er und 70er Jahren waren viele Roma unter den sogenannten Gastarbeitern. Die sich aber als solche aus Angst vor Ausgrenzung und Diskriminierung nicht zu erkennen gegeben haben. Dieses Verstecken – die Unsichtbarkeit – gibt es bis heute.
Die Kriege im ehemaligen Jugoslawien ab 1993 vertrieben viele Roma nach Westeuropa und auch nach Deutschland.
Kurzfristiger Schutz wurde zumeist über Erlasse und Duldungen geregelt. Duldung bedeutet aber nichts anderes als Aussetzung der Abschiebung,. Eine längerfristige Aufenthaltsperspektive war nicht vorgesehen.
Kaum waren die Kriege vorbei, sollten die geflüchteten Roma abgeschoben werden. Dagegen wehrten sie sich. Und tun es heute noch.
Ob 1991 oder 2002 in Düsseldorf. Oder 2015 in Berlin am Mahnmal.
Diese Kämpfe führten nicht zum Bleiberecht. Doch sie sind als Erinnerung ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben.
Seit 2012 gibt es in Berlin ein Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas. Es wurde in einem langen und schwierigen Prozess erkämpft. Es war für mich nicht glaubwürdig, als Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede zur Einweihung des Mahnmals der im Nationalsozialismus ermordeten Roma und Sinti gedachte. Denn wenige Zeit später löste ihr damaliger Bundesinnenminister Friedrich mit einem großen Interview in einer Zeitung erneut die Debatte über Asylmissbrauch von Roma aus.
Ich spreche mich gegen ein leeres Erinnern und ein kaltes Vergessen aus.
Das war der Grundstein für die Konstruktion der sicheren Herkunftsstaaten Serbien, Mazedonien, Bosnien Herzegowina, Montenegro, Albanien und Kosovo.
Seit der Entscheidung für das Gesetz zu den sicheren Herkunftsstaaten sind monatlich hunderte Roma mit Sammelabschiebungen aus Deutschland bedroht und tatsächlich abgeschoben worden. Die nächsten Abschiebungen stehen fest.
Die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im sicheren Herkunftsstaat Kosovo ist für mich ein unauflösbarer Widerspruch. Es zeigt sich ein unmäßiger Wille zur Ignoranz.
Ignoriert wird die Menschenrechtssituation vor Ort. Als Argument verwendbar ist dagegen die hohe Ablehnungsquote in den Asylverfahren, die man selbst produziert hat.
Folge der Einstufung als sichere Herkunftsstaaten sind Schnellverfahren und Unterbringung in Sondereinrichtungen – auf Verladebahnhöfen, im Wald.
Die zynische Prognose einer geringen Bleibeperspektive, der in Paragraphen gegossene Rassismus gegen Roma isoliert Menschen.
Die Not vieler südosteuropäischer Roma ist riesengroß. Das schmerzt.
Heute flüchten manche nach Deutschland. Nach jeder Abschiebung. Erneut. Immer. Wieder. Also nicht neu – sondern eine alte Geschichte: Familienleben in andauernder Migration. Dieses weitestgehend ignorierte Phänomen umfasst und überschattet Generationen, zerreißt Familien. Ihre Geschichte mit Deutschland ist historisch gewachsen. Die Verantwortung des bundesdeutschen Staates ist vielfach. Kein Rückübernahmeabkommen kann an diesem moralischen Fakt etwas ändern.
Alle Roma sind Nachkommen der Opfer des Nationalsozialismus. Unter den Abgeschobenen sind die Nachkommen der Opfer der im Nationalsozialismus ermordeten R und S in der zweiten und dritten Generation.
Wir sprechen uns gegen ein leeres Erinnern und ein kaltes Vergessen aus.
Und wie sieht es in der Realität aus? Die Proteste sind leise. Die Abschiebemaschinerie läuft. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne Rücksicht auf kranke oder traumatisierte Menschen. Kinder werden aus den Schulen geholt in Flugzeuge gepackt.
Was die Statistik schön macht: die freiwillige Rückreise. Doch Menschen mit Abschiebung zu drohen, wenn sie nicht selbstständig ausreisen, hat mit Freiwilligkeit nichts zu tun!
Für uns Erinnern heißt Abschiebungen zu verhindern.
Proteste, Kundgebungen, Demonstrationen, Gedenkveranstaltungen zu organisieren. Unser Wissen zu archivieren. Unsere Geschichte zu schreiben und unsere Rechte zu fordern.
Wir setzen uns ein für das Recht auf ein sicheres Leben für Roma, aber auch andere Minderheiten, die rassistisch aussortiert werden.
Geht diesen Weg mit uns gemeinsam!
Vielen Dank!!
Das Schicksal der europäischen Roma und Sinti während des Holocaust
Rund 500.000 Roma und Sinti wurden während des Holocaust ermordet als Opfer einer rassistischen Verfolgungspolitik deutscher Nazis und ihrer faschistischen Verbündeten. Doch dieser Völkermord ist heute weitgehend unbekannt. Roma und Sinti wurden in Vernichtungslagern getötet und fielen in Zwangsarbeits- und Konzentrationslagern Hunger und Krankheiten zum Opfer. Viele wurden deportiert und als Zwangsarbeiter ausgebeutet, auf Bauernhöfen, auf Baustellen und in der Industrie. Die Überlebenden wurden jahrzehntelang nicht als Opfer nationalsozialistischer Verfolgung anerkannt und erhielten nur geringe oder überhaupt keine Entschädigungszahlungen für ihren verlorenen Besitz. Die Homepage bietet grundlegende Informationen für SchülerInnen / LehrerInnen über den Völkermord an den europäischen Sinti und Roma.
Website: www.romasintigenocide.eu
Doğan Akhanlı: »Heute wollen wir ein Gedicht schreiben«
»Heute wollen wir ein Gedicht schreiben«
Dogan Akhanli
Wenn ich nicht nach Deutschland eingewandert wäre, hätte ich mir wahrscheinlich niemals die Verbindung zwischen eigener Vergangenheit, eigenen Erinnerungen und der Vergangenheit, den Erinnerungen der Kurden, Armenier, Aleviten, Juden und Griechen ins Bewusstsein rücken können. Die Verbindungen und die Unterschiede. Ich hätte weiterhin dem Mythos der Gründung der Türkischen Republik Glauben geschenkt und hätte gezögert, das Massaker an den Armenier als Völkermord zu bezeichnen.
Als ich nach Deutschland kam, hatte ich nicht ein einziges Buch über den Genozid von 1915 gelesen, das nicht auf Lügen basierte. Das Land, in das ich einwanderte, und mein Geburtsland, Deutschland und die Türkei, hatten seit Jahrhunderten freundschaftliche Beziehungen unterhalten. Und die Vergangenheit beider Länder war voller Traumata. Doch trotz der jeweiligen historischen Schuld gab es grundsätzliche Unterschiede zwischen beiden Ländern. Während die Vergangenheitsbewältigung und die Erinnerungsarbeit in Bezug auf die eigene historische Schuld und Verantwortung das zweite, das schöne Gesicht Deutschlands war, beharrte die Türkei nach wie vor darauf, einen der beiden bestuntersuchten, bestdokumentierten Völkermorde dieser Erde, den an den Armeniern, für den sie Verantwortung trug, zu leugnen, und weigerte sich beharrlich, sich diesem historischen Unrecht zu stellen.
Erstmals 1999 wurde, in der Kölner Aufarbeitungsgeschichte, eine Veranstaltungsreihe „Genozid und Gedenken“ zum Thema Völkermord an den Armeniern organisiert. Jeder von uns, die aus der Türkei stammten, kannte mindestens eine Geschichte über Gräueltaten an den Armeniern, hatte sie schon als Kind oder später als junger Mensch oder noch später als Erwachsener gehört. Aber egal ob man Linksradikaler war, Nationalist oder frommer Muslim: es existierte damals eine unausgesprochene Übereinkunft, die für alle galt: Ignorieren, Schweigen, Leugnen, sobald die Vernichtung der Armenier von 1915-1916 zur Sprache kommt. Die Nationalisten und Ultrarechtnationalisten wollten diese Auseinandersetzung torpedieren, indem sie Veranstaltungen zu sprengen versuchten. Doch es gelang ihnen nicht.
Nach der Veranstaltungsreihe „Genozid und Gedenken“ wurde die Idee geboren, im ehemaligen Kölner Gestapogefängnis, dem heutigen NS- Dokumentationszentrum der Stadt, regelmäßig türkischsprachige Führungen anzubieten. In den Führungen wurden Antworten auf Fragen gesucht wie diese: Ist die Holocaust nur eine jüdisch-deutsche Geschichte oder/und auch eine transnationale Geschichte? Ist der Völkermord an den Armeniern für Deutschland eine „fremde“ Geschichte? In der Ausstellung des NS-Dokumentationszentrums gibt es Dokumente, die zeigen, wie sehr die Geschichte des Holocaust auch eine deutsch-türkische ist. Über Salomon Freud zum Beispiel. Er wurde am 24. September 1884 in Konstantinopel geboren und besaß die türkische Staatsangehörigkeit, ebenso wie seine Frau Hedwig und sein Sohn Alfred. Die Familie Freud siedelte nach Deutschland über und wohnte bis 1939 in Köln. Hedwig, Salomon und Alfred Freud wurden am 3. September 1942 zuerst nach Theresienstadt und dann nach Auschwitz deportiert und gelten als „verschollen.“ Ihr Schicksal ist kein Einzelfall. Während der Shoah wurden über 3.000 türkische Bürger in Europa ermordet (Guttstadt 2008).
Ein Exponat in der Dauerausstellung in Köln erzählt uns, dass Adolf Hitler und Franz von Papen am 4. Januar 1933 Gespräche über eine gemeinsame Regierungsbildung in einer Villa führten (Stadtwaldgürtel 35). Franz von Papen war im Ersten Weltkrieg von 1915 bis 1918 Stabschef der 4. Türkischen Armee. Mit dem Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk besuchte er Palästina, ab April 1939 war er Botschafter in Ankara (Gottschlich 2015). Die türkischen Streitkräfte im Ersten Weltkrieg standen weitgehend unter deutschem Oberbefehl. Zum Beispiel unter dem von General Otto Liman von Sanders, der im „Prozess Talaat Pascha“ als Sachverständiger auftrat (Hofmann 1980). Die wahren Täter des Völkermords (unter ihnen Talat, Enver und Cemal Paşa) flohen mithilfe der Deutschen nach Berlin. In dem Jahr, in dem ein junger Mann namens Raphael Lemkin mit dem Jurastudium begann, wurde der Hauptverantwortliche der Armenier-Deportationen, Unterzeichner der Deportationsbefehle, Innenminister und Großwesir Talat Paşa, am 15 März 1921 in der Hardenbergstraße in Berlin von Soghomon Tehlirian erschossen.
Lemkins späterer Kommentar zu diesem Ereignis war: „Der Talat-Paşa-Prozess von 1921 war sehr lehrreich. Ein Mann, dessen Mutter beim Völkermord getötet wurde, Soghomon Tehlirian, tötet Talat Paşa. Sehen Sie, als Rechtsanwalt habe ich gedacht, dass ein Vergehen nicht durch das Opfer, sondern durch ein Gericht, durch nationale Justiz bestraft werden müsste.“ Den Einfluss des Völkermords an den Armeniern auf die Formulierung der Völkermordkonvention beschreibt Lemkin folgendermaßen: „Das Leid der armenischen Männer, Frauen und Kinder, die in den Euphrat geworfen oder auf dem Weg nach Deir ez-Zor massakriert wurden, war der Wegbereiter zur Annahme der ‚Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes‘.“
Raphael Lemkin verlor als schwuler Jurist alle Angehörigen (mit Ausnahme seines Bruders und seiner Schwägerin) im Holocaust. Er starb 1959, völlig verarmt, in New York. Auf seinem Grabstein steht: Father of the Genocide Convention.
In der 256 Seiten umfassenden Urteilsschrift der Nürnberger Prozesse, bei denen die Hauptkriegsverbrecher des Nazi-Regimes vor Gericht gestellt wurden, sind der Vernichtung der europäischen Juden lediglich drei Seiten gewidmet. Der Begriff Völkermord wird in der Anklageschrift dieses Prozesses erstmalig verwendet. Es ist das erste offizielle Dokument, in dem erwähnt wird, dass es sich bei dem Völkermord an den Armeniern um „den ersten Genozid des Jahrhunderts (handelt), bei dem 1,4 Millionen christliche Armenier auf Befehl der türkischen Regierung getötet wurden“.
Trotz der unverzeihlichen Schwächen der Sicherheitsbehörden, die die NSU-Morde sowie ähnliche Übergriffe und Anschläge nicht verhindern konnten, hat die heutige Erinnerungskultur Deutschlands nicht nur für das Land selbst, sondern auch auf internationaler Ebene große Bedeutung. Die NSU-Morde sind gleichzeitig auch eine bittere Warnung, nicht zu vergessen, dass Erinnerungskultur nicht statisch ist, sondern ein Prozess, in dessen Verlauf jede Generation ihre Art, ihre Mittel der Geschichtsaufarbeitung immer wieder überdenken und weiterentwickeln muss.
Die Geschichtsaufarbeitung der Türkei ist eine Erfahrung der Leugnung, die eine wissenschaftliche Untersuchung wert wäre.
“Es giebt andererseits auch sehr wenig Türken,“ schrieb der Korrespondent der „Kölnischen Zeitung“ (Tyszka ) am 15.9.1915, „mit denen man offen über die Armenierfrage reden kann, gleich bricht selbst bei sonst gebildeten und weltgewandten Menschen eine Wut durch, die alles in einen Topf wirft und die immer mit dem Refrain endet: „Alle Armenier gehören ausgerottet, sie sind Verräter!“ [Dokumente aus dem Politischen Archiv des deutschen Auswärtigen Amts / “1915-09-05-DE-001/Quelle: PA-AA/R 14087; A 27887, pr. 24.9.1915 p.m.;]
Der Hass, der immer noch aktuell ist, mit dem in der Türkei nicht-türkischen, nicht-muslimischen Mitbürgern begegnet wird, erinnert an die Worte des israelischen Psychoanalytikers Zvi Rix: Auschwitz werden uns die Deutschen niemals verzeihen! Denn die Juden waren lebende Beweise des Geschehenen, die die Deutschen ständig an ihre Schuld erinnerten. Mit hoher Sensibilität wurde Verantwortung übernommen, wurden wichtige Maßnahmen ergriffen, Mittel und Wege zur Wiedergutmachung zu finden und auf Opfer und Überlebende des Holocausts zuzugehen. Währenddessen beharren diejenigen, die die türkische Identität überbewerten, seit hundert Jahren darauf, den Armeniern das Konzentrationslager Deir ez-Zor, das 1915/16 in der syrischen Wüste eingerichtet war, niemals zu verzeihen. Diese Herzensblindheit, vermengt mit dem Schlamm aus Leugnung und Lügen, produziert Mörder. Weil die größte Schuld unserer modernen Geschichte nicht aufgearbeitet wurde, weil kein Weg gefunden wurde, mit der Schuld umzugehen, bleiben nicht nur der Staat mit seinen Institutionen, sondern auch die Gesellschaft zu Gewalt und Mord verdammt. Vor unsert Augen wurde Hrant Dink erschossen, wurde der Mörder als Held gefeiert, ließen sich Polizisten mit ihm neben der türkischen Flagge fotografieren, feierten sie den Mord mit dem Absingen der Nationalhymne. In Malatya wurden Mitarbeiter einer Bibel-Druckerei abgeschlachtet, in Trabzon wurde ein italienischer Mönch ermordet. Selbst nach dem Tod von 50 000 Menschen wurden den Kurden die grundlegendsten Rechte vorenthalten. Die Wüste von Deir ez-Zor hörte nach einem Jahrhundert nicht auf, Menschen, nun auch andere Ethnien, zu schlucken.
Es war politisch und moralisch nicht hinnehmbar, dass Deutschland, trotz der Erfahrung der Geschichtsaufarbeitung, die Anerkennung des Völkermordes an den Armeniern bis ins Jahr 2016 hinausgezögert hat.
Es ist soweit.
Den Holocaust in Verbindung mit dem Völkermord an den Armeniern zu betrachten, bedeutete heute keine Relativierung der Schoah, sondern eine Erweiterung und Vertiefung der deutschen Aufarbeitung, die aber nicht mehr nur deutsch bleiben sollte. Denn die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts, des Jahrhunderts der Völkermorde, sollte Teil der Holocaust Education sein, und die Beschäftigung damit sollte aus dem nationalen Rahmen in einen transnationalen übertragen werden. Auschwitz verwandelte den Versuch, weiterhin Gedichte zu schreiben, zwar in Barbarei (wie Adorno sagte), aber der einzige Weg, die Existenz von Auschwitz zu ertragen und sich zur Wehr zu setzten, besteht darin, trotz Auschwitz Gedichte zu schreiben.
Und heute wollen wir ein Gedicht schreiben. Das ist der Sinn der Veranstaltung.
Über den Sinn der Matinee „Dieser Schmerz betrifft uns alle“
Matinee „Dieser Schmerz betrifft uns alle. Völkermorde erinnern, Kriege verhindern“
(Albrecht Kieser, Moderator)
Warum haben wir hierher eingeladen? Weil wir uns Sorgen machen. Weil wir den Eindruck haben, dass Deutschland an einer Scheidelinie steht.
Rassismus und Nationalismus werden wieder in beängstigendem Maße hoffähig. Große Teile der etablierten Politik lassen sich von der rechtsradikalen AfD antreiben und wenn Seehofer sich zum Vorkämpfer gegen Muslime in Deutschland stilisiert, dann ist das nur die Spitze des Eisberges.
Rassismus und Nationalismus sind Geisseln der Menschheit, Peitschen also, Plagen. Wir erleben auch in anderen Ländern täglich, wie diese Geisseln zielbewusst eingesetzt werden: Zur Stabilisierung maroder Herrschaftsapparate wie in den Vereinigten Staaten des Donald Trump, zur Rechtfertigung imperialer Kriegsmaßnahmen wie in Erdogans Reich oder zur Legitimierung flüchtlingsfeindlicher Innenpolitik, nicht nur von Ungarns Orban.
Sondern eben auch in Deutschland. Die Ihnen wahrscheinlich bekannte „Gemeinsame Erklärung 2018“ aus dem rechten bis rechtsradikalen Milieu sammelt hinter zwei Sätzen Leute wie Henryk M. Broder, Uwe Tellkamp, Thilo Sarrazin, Bassam Tibi oder Vera Lengsfeld und gut 100.000 weitere Unterzeichnerinnen und Unterzeichner.
Diese Leute wollen mit ihren zwei Sätzen einen Sturm entfachen, der hinweg fegen soll, was ihnen nicht passt: Flüchtlinge. Die Sätze lauten: „Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird.“
Nichts davon stimmt. Im Gegenteil: Die deutschen Grenzen sind spätestens seit dem Herbst 2015 wieder mörderisch dicht. Illegale Masseneinwanderung findet in keiner Weise statt, nicht einmal legale gibt es noch. Und beschädigt wurde im Sommer 2015 bestenfalls die Illusion, Deutschland sei unschuldig an den Ursachen weltweiter Migration und könne sich in ein nationales Wolkenkuckucksheim davon stehlen.
Die zwei Sätze der „Erklärung 2018“ offenbaren die Kernmethode von Rassisten und Nationalisten: die Realität durch verbale Pyrotechnik vernebeln und die Geschichte der grausigen Folgen ihrer altbackenen politischen Vorschläge mit denselben Mitteln unkenntlich machen.
Als wir die Matinee konzipiert haben, lag diese Erklärung noch nicht vor. Und obwohl sie sich scheinbar einem anderen Thema widmet als dem unsrigen, ist der Zusammenhang doch offensichtlich. Dieselben Kreise, die diese Erklärung produziert haben, fordern – Zitat – „eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ und verlangen ein Ende des von ihnen so genannten „Schuld-Kultes“.
Was wirklich Angst macht: das ideologische Zusammenspiel von Rassisten, Nationalisten und Geschichtsleugnern ist nicht auf rechtsradikale Kreise beschränkt. Im niedersächsischen Bergen hat der Stadtrat ein jahrelang vorbereitetes Kooperationsprojekt mit der Gedenkstätte Bergen-Belsen im November 2017 mit den Stimmen von CDU und Grünen abgelehnt. Der Geschäftsführer des Stiftungsrates der Stiftungen Niedersächsischer Gedenkstätten Jens-Christian Wagner sagt dazu, ich zitierte: „Die Stadträte…waren mehrheitlich recht jung. Keiner von ihnen leugnet die NS-Verbrechen. Trotzdem hat sich etwas verschoben: Das Bewusstsein, dass die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen grundlegend ist für unser demokratisches Selbstverständnis; dieses Bewusstsein und damit das Gefühl der Verantwortung schwinden – weit über die AfD hinaus.“
Wer zurück will zu einem starken völkischen Staat, muss nicht nur alles „Volksfremde“ ausmerzen. Er muss auch die Geschichte seines Staates von dessen offensichtlichen Verbrechen reinigen. Der Historiker Volker Weiß sagte dazu kürzlich: „Die eigene Nationalgeschichte soll als glorreiche Geschichte ohne Makel und ohne Schatten erinnert werden.“
Zu den grausamsten staatlichen Verbrechen Deutschlands gehören die Genozide an seinen vermeintlichen, tatsächlichen oder erklärten Gegnern. Deshalb wollen völkische Nationalisten die Genozide, die unter deutscher Führung oder deutscher Mithilfe verübt wurden, aus der lebendigen Erinnerung herausdrängen.
Wir wollen das Gegenteil.
Wir wollen eine staatskritische Erinnerungskultur erhalten und ausweiten. Auch weil wir glauben, dass das Wissen über die Geschichte der genozidalen Folgen von Rassismus und Nationalismus hilft, rassistische Ausgrenzungen in der Gegenwart besser zu erkennen und sie zu bekämpfen und nationalistische Mobilmachungen für Kriege zu behindern.
Presseerklärung: „Dieser Schmerz betrifft uns alle – Völkermorde erinnern, Kriege verhindern“
Matinee „Dieser Schmerz betrifft uns alle. Völkermorde erinnern, Kriege verhindern“
15. April 2018, 11.00 Uhr, Filmforum NRW, Köln
Alte und neue Nationalisten betreiben mit großer Energie eine erinnerungspolitische Wende, um das Gedenken an deutsche Menschheitsverbrechen zu löschen.
Die Veranstaltung „Völkermorde erinnern – Kriege verhindern“ am 15.4. um 11 Uhr im Filmforum NRW Köln (Museum Ludwig) stellt sich gegen die Rückkehr zu verlogenen Geschichtsbildern.
Denn wo heute in Europa die staatskritische Erinnerungskultur ins Abseits gedrängt wird, blüht der aggressive und völkische Nationalismus auf.
Wir sprechen auf dieser Veranstaltung vom Wert und von der Unverzichtbarkeit einer kritischen Erinnerung an die genozidalen Folgen von Rassismus und Nationalismus, weil wir auch für gegenwärtiges staatliches Unrecht wach und mit dessen heutigen Opfern empathisch bleiben wollen.
Auf der Matinee werden Filmausschnitte von Aghet (Eric Friedler), Skulls of my people (Vincent Moloi) und A people uncounted (Aaron Yeger) gezeigt.
Redebeiträge für das Erinnern und gegen das Verschweigen halten Israel Kaunatjike (Namibia-Aktivist, zum Völkermord an OvaHerero und Nama), Dogan Akhanli (Schriftsteller, zum Völkermord an den Armeniern), Peter Finkelgruen (Schriftsteller und Autor, zur Shoah) und Nizaqete Bislimi (Vorsitzende des BundesRoma-Verband e.V., zum Genozid an den Roma und Sinti).
Musikalisch gerahmt wird die Matinee durch Beiträge des kurdischen Gitarrenduos Meral & Evin.
Veranstalter: Initiative Völkermord Erinnern; recherche international e.V., FilmInitiativ Köln e.V.
Unterstützt von: Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V., Kulturforum TürkeiDeutschland e.V., Jugendclub Courage e.V., Anerkennung Jetzt!
www.voelkermord-erinnern.de;
Wir bitten freundlich um Berichterstattung.
Das Mahnmal ist an der linksrheinischen Seite der Hohenzollernbrücke errichtet worden, gegenüber dem Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm II., Verantwortlicher für den Völkermord an den OvaHerero und Nama 1904 und Unterstützer des Genozids an den Armeniern.
Das Genozid-Mahnmal wurde von der Stadt Köln am 19. April 2018 abgerissen. Es habe an einer Genehmigung gefehlt. Die Stadt hat in ihrem Schriftsatz gegenüber dem Verwaltungsgericht Köln, das wir angerufen hatten, außerdem argumentiert, das Mahnmal müsse noch vor dem 24. April, dem internationalen Gedenktag an den Genozid, beseitigt werden, weil sonst die Gefahr bestehe, dass sich „zahlreiche Gegendemonstranten einfinden“ und „die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs an dieser Stelle zeitnah stark beeinträchtigt“ sei. „Angesichts der Vielzahl türkischer Mitbürger in Köln“ sei auch schon 2017, bei der Erlaubnis für den Kreuzstein der armenischen Gemeinde „auf eine Aufstellung im öffentlichen Straßenland aufgrund des hohen Konfliktpotentials bewusst verzichtet worden“. Das Verwaltungsgericht Köln hat die sofortige Entfernung des Genozidmahnmals an der Hohenzollernbrücke nicht beanstandet.
In unserer Antwort beim Verwaltungsgericht hielten wir fest, dass wir diese Argumentation für ein erinnerungspolitisches Armutszeugnis und ein Ausweichen vor Genozidleugnern halten. Sie widerspricht diametral der Aufforderung des Bundestags, der in seiner Resolution vom 2. Juni 2016 die Zivilgesellschaft auffordert, das Gedenken an den armenischen Genozid zu thematisieren.
Zahlreiche Organisationen und Prominente haben sich mittlerweile als PatInnen und UnterstützerInnen für das Mahnmal und für seine Wiedererrichtung ausgesprochen.
Wir richten unsere Anstrengungen weiterhin darauf, möglichst viele zivilgesellschaftliche Kräfte in dem Bemühen zu vereinen, die Stadt Köln solle das Genozid-Mahnmal wieder aufstellen.
Das Mahnmal muss an seinen Platz zurück!
L’initiative « Rappeler le Génocide » ainsi que les visiteurs ont inauguré le 15 avril 2018 à Cologne un monument à la suite d’une matinée sur le thème « Rappeler le génocide, Empêcher les guerres ». Il rappelle non seulement le génocide commis dans les années 1915 – 1918 aux Arméniens mais également la participation allemande et exige de proscrire le racisme et le nationalisme comme la cause des génocides.
Le monument a été érigé sur le bord gauche du pont sur le Rhin, le« Hohenzollernbrücke » en face de la statue du Kaiser Wilhelm II, responsable du génocide des OvaroHerero et Nama en 1904 et soutien du génocide des Arméniens.
Le Monument a été enlevé par la ville de Cologne le 19 avril 2018, pour manque d’autorisation préalable. La ville de Cologne a également argumenté, dans le cadre d’une procédure devant le tribunal administratif de Cologne entamée par nous, que le monument devrait être enlevé avant le 24 avril 2018, jour de la commémoration internationale du génocide aux Arméniens, afin d’éviter « le rassemblement de nombreux contre-manifestants » présentant un fort risque pour « la sécurité et la facilité du trafic à cet endroit ». Au vu de la présence de nombreux citoyens turcs à Cologne, la ville aurait déjà en 2017, lors de la mise en place du « Kreuzstein » de la communauté arménienne, refusé expressément une permission de la mise en place dans le domaine public à cause du potentiel de conflit élevé.
Le tribunal administratif de Cologne n’a pas contesté l’enlèvement immédiat du monument du génocide près de la «Hohenzollernbrücke».
Dans notre réponse au tribunal administratif nous avons souligné que nous jugeons cette argumentation comme insulte à une politique de mémorisation et un recul devant ceux qui nient le génocide. Elle contredit diamétralement la demande du Bundestag qui dans sa résolution du 2 juin 2016 demande à la société civile de thématiser la mémoire du génocide aux Arméniens.
Un grand nombre d’organisations et de personnes importantes de la vie culturelle et intellectuelle se sont déclarées parrain ou soutien pour le monument et sa réinstallation.
Nos efforts continuent afin qu’un grand nombre de personnes de la vie civile se réunisse pour exiger de la ville de Cologne la réinstallation du monument du génocide.
LE MONUMENT DOIT RETOURNER A SA PLACE!
Presseerklärung 15.4. 2018 – Initiative Völkermord erinnern
Presseerklärung 15.4. 2018 – Initiative Völkermord erinnern
Völkermord-Mahnmal errichtet!
Im Anschluss an die Matinee „Völkermorde erinnern, Kriege verhindern“ am 15. April in Köln haben die Initiative „Völkermord erinnern“ und Besucherinnen und Besucher eine Skulptur enthüllt. Es ist das erste Mahnmal in Deutschland im öffentlichen Raum, das an den mit deutscher Beteiligung durchgeführten Genozid an den Armeniern in den Jahren 1915-1918 erinnert.
Das Mahnmal, das von den Kölner Künstlern Stefan Kaiser und Max Scholz realisiert wurde, ist an der linksrheinischen Seite der Hohenzollernbrücke errichtet worden. Es steht gegenüber dem Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm II., Verantwortlicher für den Völkermord an den Ovaherero und Nama 1904 und Unterstützer des Genozids an den Armeniern.
Bereits im vergangenen Jahr hatte die armenische Gemeinde Köln mit Unterstützung des Kölner Stadtrats auf dem Brücker Friedhof einen Kreuzstein zur Erinnerung an die Opfer des Genozids aufgestellt. Wir sehen in dem heute von uns an einem exponierten Ort in Köln aufgestellten Mahnmal eine wichtige Ergänzung der letztjährigen Initiative.
Auf der dreiseitigen stählernen Pyramide, auf deren gekappter Spitze ein seitlich geschlitzter Granatapfel aus Bronze ruht – als ein Symbol für den Genozid an den Armeniern – ist in armenisch, deutsch, türkisch und englisch die folgende Inschrift angebracht:
Dieser Schmerz betrifft uns alle
Während des 1. Weltkrieges – zwischen 1915 und 1918 – wurden in der heutigen Türkei über eine Million armenische Frauen, Männer und Kinder aus ihren Häusern vertrieben, deportiert und ermordet. Das Osmanische Reich und die beteiligten deutschen Offiziere unter Führung Kaiser Wilhelm II. tragen die Verantwortung für diesen Völkermord an der armenischen Bevölkerung.
Nur eine entschiedene Ächtung der Entwürdigung von Minderheiten und die Einsicht, dass es weder religiöse, nationale noch ethnische Überlegenheit zwischen den Menschen gibt, kann solche Verbrechen verhindern.
Die Überschrift „Dieser Schmerz betrifft uns alle“ nimmt die jährliche Erinnerungsaktion in der Kölner Partnerstadt Istanbul auf, die unter demselben Titel steht. Die Wiedererrichtung eines historischen Mahnmals im Gezi-Park in Istanbul ist von den türkischen Behörden bislang verhindert worden.
Die Initiator*innen der heutigen Aktion haben das Mahnmal den Kölner Bürger*innen und ihren gewählten Vertreter*innen geschenkt und der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker eine Schenkungsurkunde zugestellt.
Neben den Gruppen, die zur Matinee aufgerufen haben (s.u.), wird die Errichtung des Mahnmals von folgenden Personen unterstützt, die eine Patenschaft für die Skulptur übernommen haben:
– Doğan Akhanlı, Schriftsteller
– Prof. Dr. Micha Brumlik, eh. Leiter des Fritz-Bauer-Instituts Frankfurt
– Gunter Demnig, Künstler (Stolpersteine)
– Çiler Fırtına, Dolmetscherin
– Prof. Dr. Martin Pätzold, Mitglied des Bundestages 2013-2017
– Dr. Martin Stankowski, Stadthistoriker
– Günter Wallraff, Journalist
– Ragıp Zarakolu, Menschenrechtsaktivist
Auf unser Website www.voelkermord-erinnern.de finden Sie Fotos zur Ihrer Verfügung.
Initiative Völkermord Erinnern; recherche international e.V., FilmInitiativ Köln e.V., Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V., Kulturforum TürkeiDeutschland e.V., Jugendclub Courage e.V., Anerkennung Jetzt!
Wir bitten freundlich um Berichterstattung.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an .
Rede Peter Finkelgruen: 11 Jahre Geschichtserinnerung
Matinee-Rede von Peter Finkelgruen
Vor wenigen Tagen wurde der Seder-Abend begangen. Es ist der erste Abend des siebentägigen Pessah Festes. Auch wenn ich kein religiöser Mensch bin, so nehme ich doch gern an der Feier dieses Festes teil. Das liegt nicht zuletzt an einem Satz. Es ist ein Satz der über Erinnerung spricht und die Bedeutung die geschichtliche Erinnerung für den Menschen hat. Der Satz lautet:
„In jeder Generation sollte jeder Mensch sich betrachten, als ob er ganz persönlich aus Ägypten befreit worden wäre.“
Als ich im Jahr 1988 nach einem knappen Jahrzehnt der Arbeit in Jerusalem nach Deutschland zurückgekehrt bin ahnte ich nicht daß mir mehr als ein Jahrzehnt bevorstand in dem ich mich einer permanenten Konfrontation ausgesetzt sehen würde. Einer Konfrontation mit der Justiz dieses Landes. Einem Jahrzehnt daß eine einzige tägliche Erinnerung an die Geschichte dieses Landes und an die Untaten. die im Dritten Reich begangen wurden war. Das ich elf Jahre lang mich in die Geschichte vertiefen müste um in der Lage zu sein den Mann, der meinen Grossvater in der kleinen Festung Theresienstadt erschlagen hat, vor die Schranken eines Gerichts in der Bundesrepublik Deutschland zu bringen.
Während meiner Jahre in Israel erhielt ich Fotokopien von Briefen die meine Eltern auf ihrer Flucht vor den NS Schergen geschrieben haben. Es waren knapp dreißig lange und ausführliche zumeist Schreibmaschinengeschriebene Briefe. Sie wurden auf der Flucht aus Prag, ihrer letzten Station in Europa, in die Emigration nach Shanghai in China und von dort selbst geschrieben.
Schon vor der Rückkehr nach Deutschland hatte ich die Absicht gefasst diese Brief zu nutzen wie einen Reiseführer und die Reiseroute nach zu reisen. Meine Frau und ich beschlossen, diese Reise in Etappen zu absolvieren und fuhren nach Prag, der ersten Station der Reise. Mein Vater stammte aus Bamberg, meine Mutter aus Karlsbad. Sie heirateten in Prag. Dort began ihre Emigrationsreise, die sie bis nach Shanghai führen sollte. In Prag lebte meine Großmutter mütterlicherseits und mein Großvater väterlicherseits Sie war Christin. Er war Jude. Sie versteckte ihn in ihrer Wohnung.
Die nationalsozialistische Verfolgung der Juden erreichte schließlich aber auch Shanghai, wo die japanischen Verbündeten des Deutschen Reichs auf dessen Fordern und Drängen ein Getto für die circa 30 000 Flüchlinge erichtet haben. Dort wurde ich geboren. Meine Eltern waren von Nachrichten über ihre Eltern abgeschnitten. Mein Vater starb im im gleichenJahr. Eine Folge der miserablen hygienischen und medizinischen Verhältnissen. Ich überlebte mit meiner Mutter.
Nach dem Krieg und der Befreiung durch die Amerikaner erfuhr meine Mutter daß ihre Mutter Jahre der Haft in Konzentrationslagern überlebt hatte und daß ihr Schwiegervater, mein Großvater väterlicherseits, Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung wurde.
Diese elf Jahre der Konfrontation begannen für mich im Februar 1989, in dem Moment in dem eine Freundin meiner Großmutter, die ich in Prag besuchte, mir unter Tränen erzählte wie und von wem mein Großvater in der kleinen Festung Theresienstadt ermordet wurde. Meine Großmutter hatte mir, ehe sie selbst verstarb, oft erzählt daß mein Großvater nach ihrer gemeinsamen Verhaftung durch die Gestapo in der kleinen Festung Theresienstadt, einem Gefängnis der Gestapo Prag, gestorben war. Sie hatte mir aber nicht erzählt wie er zuTode kam, geschweige denn daß sie den Namen des Mörders genannt hätte. Sie kannte ihn nicht.
Ich hatte den Namen allerdings wenige Monate vor meinem Besuch in Prag in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Eine kleine Nachrichtennotiz auf Seite 5 unten besagte daß der 1949 in der CSSR als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilte Anton Malloth von Italien in die Bundesrepublik abgeschoben worden sei. Die zuständige Statsanwaltschaft in Dortmung habe erklärt daß sie kein Interesse an der Auslieferung gehabt habe da „kein dringender Tatverdacht“ gegeben sei. Diese Meldung entsprach der Beiläufigkeit, die bei der Verfolgung von NS Verbrechen in den achtziger Jahren – und davor – in der Bundesrepublik zur Regel geworden war.
Auf der Rückfahrt von Prag und Theresienstadt wohin wir nach dem Besuch bei der neunzig Jahre alten Freundin meine Großvater fuhren, wurde uns war klar dass das Projekt der Reise entlang der Fluchtroute meiner Eltern, nun ad acta gelegt werden musste. Ich musste entscheiden wie ich auf die Nachricht die ich erhalten habe und auf das Wissen um den Mörder meines Großvater reagieren sollte. Ich kann nicht verleugnen, daß ich durchaus attavistische Regungen verspürte und unterschiedlichste Rachephantasien gehabt habe. Sie entwickelten sich entlang eine ganzen Skala von physischer Konfrontation und dem Einsatz meine Fäuste bis zur Handfhabung einer Pistole, die ich mir nachts am Kölner Hauptbahnhof besorgen würde – das Darknet gab es damals noch nicht -. Nur wenige Jahre später kam eine weitere Variante hinzu. Mit Freunden wurden dreimal Pläne entwickelt, den Mörder der die Jahre nach seiner Ausweisung in die Bundesrepublik in München Pullach in einem Altersheim in direkten Nachbarschaft zum BND lebte, zu entführen und bei der Polizei in Theresienstadt sozusagen abzuliefern.
Durchgesetzt hat sich keine dieser Phantasien. Durchgesetzt hat sich die Überzeugung, dass es richtig und notwendig sei den Rechtstaat Bundesrepublik herauszufordern und das Recht durchzusetzen. Die naive Vorstellung es müße eine Selbstverständlichkeit sein daß in diesem Land ein Mörder angeklägt und seine Tat vor Gericht öffentlich verhandelt wird.
Ich kann nicht sagen ob ich diese Entscheidung damals so getroffen hätte wenn ich gewusst hätte, daß es elf Jahre Arbeit, Geld und des vollen Einsatzes aller Möglichkeiten bedürfen würde um das Ziel zu erreichen.
Obwohl – meine bisherigen Erfahrungen in und mit der Bundesrepublik Deutschland, bei Fragen der Verfolgung von NS-Verbrechen und ihr Umgang mit der Ära des Nationalsozialismus hätten mir eine Warnung sein können.
Mein Engagement in Sachen Edelweispiraten in Köln. Die Konfrontation mit der Hartleibigkeit der Behörden, die Jahre brauchten, um den Widerstandscharakter der Edelweispiraten anzuerkennen Sie haben im Gegensatz zum größten Teil der bürgerlichen Gesellschaft dieser Stadt einen Beitrag zu Rettung der Ehre dieser Stadt geleistet.
Ich habe bei Yad Vashem in Jerusalem den Antrag gestellt drei Personen aus dem Umkreis der Edelweispiraten als Gerechte unter den Völkern anzuerkennen. Eingereicht habe ich von mir gesammelte Unterlagen über das Verstecken mehrerer jüdischer Personen durch die Edelweispiraten. Allerding durfte ich erleben daß der Kölner Oberbürgermeister vor dem Rat der Patenstadt Tel-Aviv ein Rede hielt in der er die Edelweispiraten als eine kriminelle Gang charakterisierte.
Natürlich wußte ich auch um die Erfahrungen des Frankfurter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer was die Unzuverlässigkeit der Justiz, NS Verbrecher ihrem gerechten Urteil zuzuführen anging.
Es waren Jahrzehnte der frühen Bundesrepublik, die von Namen wie Globke, dem Kommentator der Nürnberger Gesetze und unter dem Kanzler Adenauer Chef des Kanzleramtes, Bundesministern wie Oberländer der an Kriegsverbrechen in Lemberg beteiligt war geprägt war. Die Liste der Namen ehemaliger Kriegsverbrecher im öffentlichen Dienst und an Schaltstellen des öffentlichen Lebens, ließe sich beliebig fortsetzen.
Die Grundlage dieses dunklen Kapitels der frühen Bundesrepublik war wohl ein Artikel des Grundgesetzes diese Landes. Es war der Artikel 131 dieses Gesetzes mit Verfassungsrang. Er lautet:
Die Rechtsverhältnisse von Personen einschließlich der Flüchtlinge und Vertriebenen, die am 8. Mai 1945 im öffentlichen Dienste standen, aus anderen als beamten- oder tarifrechtlichen Gründen ausgeschieden sind und bisher nicht oder nicht ihrer früheren Stellung entsprechend verwendet werden, sind durch Bundesgesetz zu regeln. Entsprechendes gilt für Personen einschließlich der Flüchtlinge und Vertriebenen, die am 8. Mai 1945 versorgungsberechtigt waren und aus anderen als beamten- oder tarifrechtlichen Gründen keine oder keine entsprechende Versorgung mehr erhalten.
Mit einfachen Worten: allen, die Beamte und Funktionsträger des Staates unter den Nationalsozialisten waren, wurden ihre Rechte, ihre Stellung und ihre Pensionen garantiert.
All das wissend habe ich mich daran gemacht die Justiz dieses Staates herauszufordern und zu verlangen daß der Mörder meine Großvaters für seine Taten vor Gericht gestellt wird. Wenn ich das alles so bedenke, klingt es ein wenig nach naiver Allmachtsphantasie. Bewusst war ich mir dessen damals so nicht.
In den Jahren die folgten musste ich alle meine Fähigkeiten und Kenntnisse, die mein Beruf als Journalist, meine Erfahrungen in der deutschen Politik und meine Kontakte permanent mobilisieren und einsetzen. Von den finanziellen Kosten ganz zu schweigen.
Das ich bei meinen Bemühungen auch in Visier der Stillen Hilfe geraten würde, habe ich damals auch nicht gewusst. Die Stille Hilfe ist eine Organisation, die sich für Anton Malloth gleich nach seiner Ankunft in München nach der Ausweisung aus Italien einsetzte.
Anton Malloth wurde geholfen. Gudrun Burwitz nahm sich höchstpersönlich seiner Sache an. Die Tochter Heinrich Himmlers, eine Art grauer Eminenz der rechten Szene in Deutschland, sorgte dafür, dass Anton Malloth in ein komfortables Altersheim umziehen konnte und dort jahrelang unbehelligt blieb – die Kosten für die Unterbringung übernahm das Sozialamt der Stadt München. Zur gleichen Zeit war dieser Sozialhilfeempfänger Besitzers eines beachtlichen Hauses in Meran. Gudrun Burwitz war eine der tragenden Säulen der „Stillen Hilfe für Internierte und Kriegsgefangene“, einem Verein, der jahrzehntelang aufgrund von Gemeinnützigkeit keine Steuern bezahlen musste. Einem Verein, der nicht nur als die erste Neonaziorganisation in der Bundesrepublik gelten kann, sondern der auch das Netz der braunen Kameraden nach dem Krieg weiter wob und eine ungebrochene Kontinuität bewirkte, auf der die rechte Szene heute aufbauen kann.
Der Leiter der Kreisverwaltung München bei der sich die Stille Hilfe erfolgreich für Anton Malloth einsetzte war
Hans-Peter Uhl. Er war von 1987 bis 1998 als Kreisverwaltungsreferent Leiter der Sicherheits- und Ordnungsbehörde der Landeshauptstadt München. Er war der Verantwortliche dafür dass Anton Malloth auf Kosten des Sozialamtes einen Platz im dem Altersheim in Pullach bekam. Er war auch verantwortlich dafür daß Anton Malloth deutche Personalpapiere ausgestellt bekam – und das obwohl Anton Malloth in Italien die deutsche Staatsbürgerschaft amtlich und nachweislich aufgegeben hat. Diese Tatsache, die Ausstellung deutscher Personalpapiere, sollte sich im kommenden Jahrzehnt als wirksamer Schutz vor rechtlicher Verfolgung des Anton Malloth erweisen. Die tschechische Regierung konnte ihre Forderung nach Auslieferung des Anton Malloth nicht durchsetzen, da das deutsche Grundgesetz die Auslieferung deutscher Staatsbürger verbietet.
Hans Peter Uhl wurde 1998 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er wurde innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Justitiar seiner Fraktion. Bei ihm musste ich immer an das Sprichwort vom Bock als Gärtner denken.
Unter dem Schutz den die Kreisverwaltung München dem Mörder meines Großvater angedeihen ließ brauchte Anton Malloth auch die Ermittlungen der Zentrallstelle im Lande Nordrhein-Westfalen für die Bearbeitung von national-sozialistischen Massenverbrechen bei der Staatsanwaltschaft Dortmund, nicht zu fürchten. Schließlich hatte diese Dienststelle der NRW Justiz den Komplex Kleine Festung Theresienstadt ja bereits lange Zeit bearbeitet. Bereits im ersten und zweiten Jahr meiner Bemühungen erhielt ich Zugang zu diesen Ermittlungsakten. Für mich war das wichtigste Dokument aus diesem Ermittlungsverfahren eine Art Zusammenfassung die der Staatsanwaltschaft Dortmund dazu diente das Verfahren gegen Anton Malloth immer wieder einzustellen. Es war eine 248 Seiten lange Zusammenfassung der ermittelten Verbrechen in diesem Gestapogefängnis und eine Zuordnung von Opfern und Tätern. Da waren 146 verdächtige Täter und 764 Fälle von Mord aufgeführt. Dieser Komplex „Straftaten im Gestapogefägnis Kleine Festung Theresienstadt„ wurde über 25 Jahre , also ein Vierteljahrhundert ermittelt ohne daß eine einzige Anklage geschweige denn Verurteilung folgte.
Meine Aufgabe und meine Anstrengungen in den ganzen Jahren war nun, die wiederholten Bemühungen der Staatsanwaltschaft das Verfahren einzustellen, zu verhindern. Zu verhindern daß der Mord an meinem Großvater „zu den Akten“ gelegt wurde, der Mörder weiter seine Unterstützung im Altersheim in München genießen konnte.
Ich mußte mit Hilfe befreundeter Juristen. Journalisten und Künstlern immer wieder die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erringen und auf den Fall lenken. Ich schrieb zahllose Artikel, und zwei Bücher die Aufmerksamkeit erhielten. Der Filmemacher Dietrich Schubert drehte zwei Dokumentarfilme zum Thema die im deutsche Fernsehen gezeigt wurden. Der Bühnenautor Joshua Sobol, schrieb ein Theaterstück mit dem Titel „Schöner Toni“ – das war der Spitzname von Anton Malloth in Theresienstadt. Es wurde im Schauspielhaus Düsseldorf in Anwesenheit des damaligen Ministerpräsidenten Rau uraufgeführt, und es wurde in Jerusalem, in Wien und in der Schweiz nachgespielt.Der Leiter des Simon Wiesenthal Zentrums in Jerusalem engagierte sich in dem Fall.
Die Reaktion des zuständigen Staatsanwalts bei einer Gelegenheit war nicht eine Anklage gegen Anton Malloth zu erheben – sondern eine Klage gegen Ralph Giordano zu einzureichen. Dieser hatte den Staatsanwalt in einer Rezension meins Buches „Haus Deutschland“ einen „emotionslosen Ochsenfrosch“ genannt. Seine Klage hatte der Dortmunder Staatsanwalt allerding fünf Minuten nach Eröffnung des Verfahren vor dem Frankfurter Gericht zurückgezogen. Bekanntgegeben wurde dies zur gleichen Zeit vom damaligen NRW Justizminister Krumsiek im Landtag in Düsseldorf. Abgeordnete, besonders die damalige Abgeordnete Brigitte Schuman der Grünen hatte sich in zahlreichen Anfragen an die Landesregierung mit Unterstützung ihre Fraktion vehement in der Sache engagiert. Auch Bundestagsabgeordnete haben sich in diesem Fall engagiert und an die auf einander folgenden Bundesjustizminister gewandt. Erwähnen will ich zwei. Den Abgeordneten Christian Ströbele und den damaligen Abgeordneten Guido Westerwelle. Es waren aber nicht nur die Legislativen in Düsseldorf und in Bonn die ich mit der Sache befasste. Im Landtag von Bayern kam es zu Anfragen. Auch im Ausland gab es Zeitungs- und Fernsehberichte. Es folgten Verlautbarungen Stellungnahme der Regierungen in Prag und Wien. Kurz vor dem Ende der Affäre hat die bayerische Landesregierung einen Emisär nach Rom geschickt der die italienische Regierung bewegen sollte die Bestätigung der Staatenlosigkeit Malloths ungeschehen zu machen. Er hatte keinen Erfolg. Ich überreichte zu der Zeit in Prag der dortigen Regierung ein juristischen Gutachten daß die Staatenlosigkeit Anton Malloths belegte und feststellte. Prag konnte nun seine Auslieferung aus Bayern verlangen. Kurz ehe die Entscheidung des damaligen bayrischen Ministerpräsidenten als Kanzlerkandidat ins Rennen zu gehen, bekannt wurde, erfolgte die Festnahme Anton Malloth in dem Altersheim in München Pullach und die Anklage vor dem München Strafgericht, der die Verhandlung und die Verurteilung des Mörders meines Großvaters folgte.
Rede zur Enthüllung des Kölner Mahnmals »Dieser Schmerz betrifft uns alle«
Rede zur Enthüllung des Kölner Mahnmals »Dieser Schmerz betrifft uns alle«
Köln, 15. April 2018
Das Mahnmal, das gerade von unseren Gästen der Matinee enthüllt worden ist, hat folgende Inschrift in deutscher, armenischer, türkischer und englischer Sprache:
Dieser Schmerz betrifft uns alle
Während des 1. Weltkrieges – zwischen 1915 und 1918 –
wurden in der heutigen Türkei über eine Million armenische
Frauen, Männer und Kinder aus ihren Häusern vertrieben,
deportiert und ermordet. Das Osmanische Reich
und die beteiligten deutschen Offiziere unter Führung Kaiser
Wilhelm II. tragen die Verantwortung für diesen
Völkermord an der armenischen Bevölkerung.
Nur eine entschiedene Ächtung der Entwürdigung
von Minderheiten und die Einsicht, dass es weder religiöse,
nationale noch ethnische Überlegenheit
zwischen den Menschen gibt, kann solche Verbrechen verhindern.
Das Mahnmal steht an einem besonderen Ort:
Es ist in unmittelbarer Nähe zum Reiterstandbild Kaiser Wilhelm II. errichtet worden. Dieser trägt als Staatsoberhaupt des deutschen Kaiserreichs erhebliche Mitverantwortung am Genozid an der armenischen Bevölkerung. Ihm, seinen Diplomaten und Offizieren war von Beginn an klar, dass die osmanischen Verbündeten die Armenier vernichten werden. Deutsche Militärs und Diplomaten besetzten Schlüsselpositionen im militärischen und zivilen Staatsapparat des osmanischen Reiches. 1913 waren fast 800 deutsche Offiziere in Istanbul zur militärischen Aufrüstung des Bündnispartners stationiert.
In der heutigen Matinee sind wir an die grausamen Geschehnisse während der Völkermorde an den OvaHerero und Nama, den Armeniern, aber auch Hunderttausenden Aramäern/Assyrern und Pontosgriechen, den Juden Europas und den Roma und Sinti erinnert worden. Wir möchten hier nur noch an einem Beispiel die unmittelbare Beteiligung der deutschen Industrie an der Vernichtung der Armenier zeigen:
Sie wurden zehntausendfach zu Zwangsarbeiten gezwungen unter anderem beim Bau der Bagdad-Bahn, die unter deutscher Federführung stattfand. In den eingerichteten Zwangsarbeitslagern endete die Arbeit für die meisten mit dem Tod. Unter anderem die Deutsche Bank, die Philipp Holzmann AG, Krupp und Borsig verdienten ihr Geld mit diesem Projekt. Die Bagdadbahn wurde für die Deportationen der Armenier eingesetzt. Der Transport in doppelbödigen Hammelwaggons musste von den Opfern selbst bezahlt werden.
Der Deutsche Bundestag hat 2016 in seiner Resolution anerkannt, dass der Deutsche Staat am Genozid an den Armeniern beteiligt gewesen ist. Von seiner Aufforderung, sich mit diesem Verbrechen auseinander zu setzen, haben wir uns angesprochen gefühlt und das Mahnmal errichtet.
Hier in Köln sind wir mit einer besonderen kommunalpolitischen Geschichte konfrontiert: Im Frühjahr 2017 haben 44 türkische Vereine und Verbände aus Köln und Umgebung einen Protest-Brief an die Stadt Köln geschickt. Sie wenden sich darin gegen einen „Gedenkstein zur Erinnerung an den Völkermord an Armeniern im Osmanischen Reich“ auf einem Friedhof in Köln Brück, auf dem sich neben dem armenischen auch ein muslimisches Gräberfeld befindet. Diese türkischen Vereine und Verbände sehen die Friedhofsruhe gestört, wenn sie an diesem Stein vorbeigehen müssen.
Das von uns heute an diesem öffentlichen Ort aufgestellte Mahnmal verstehen wir als wichtige Ergänzung zu der letztjährigen Initiative der Armenischen Gemeinde Köln und dem inzwischen auf dem Friedhof aufgestellten Kreuzstein. Wir fühlen uns mit der türkischen Zivilgesellschaft eng verbunden, die in ihrer Community und vom türkischen Staat eine Aufarbeitung des Genozids fordert und um Verständigung bemüht ist.
Etwa ein Dutzend Intellektuelle haben sich schon bereit erklärte Pate für das heute enthüllte Mahnmal zu werden und dieses zu unterstützen. Zu ihnen zählen:
– Günter Wallraff
– Dogan Akhanli
– Gunter Demnig
– Martin Stankowski
– Prof. Dr. Micha Brumlik
– Çiler Fırtına
– Ragıp Zarakolu
– Peter Finkelgruen
– Muriel Mirak-Weissbach
– und Prof. Dr. Martin Pätzold
Dieses Mahnmal ist das erste in Deutschland welches neben der türkischen auch die deutsche Mitverantwortung beim Völkermord an den Armeniern thematisiert. Es setzt ein Zeichen. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Mahnmal für die ermordeten Homosexuellen während des Nationalsozialismus und in Sichtweite zum Deportationsweg der Kölner Sinti und Roma und dem Ma‘alot von Dani Karavan. Wir halten es auch für dringend geboten, dass ein würdiger Gedenkort in Berlin an den Völkermord an Ovaherero und Nama entsteht. Wir unterstützen nachdrücklich die Forderungen nach Entschuldigung und Entschädigung der Nachfahren der Völkermorde.
Wir wissen, dass das Erinnern an Menschheitsverbrechen künftige Gewalt und Vernichtung nicht verhindert, es ist kein Garant für ein friedliches Miteinander. Aber ohne dieses Erinnern verlieren wir unsere Menschlichkeit und Wunden können nicht heilen. Wir wollen für die Opfer einen würdigen Platz in der Geschichte. Wir wollen die Täter und Verantwortlichen solcher Verbrechen benennen und die Nachfolgestaaten zur Rechenschaft ziehen.
Heute sind hier Menschen mit unterschiedlichen Herkünften zusammen gekommen. Wir lassen uns nicht ethnisieren, nicht nationalisieren, wir wollen ein Leben ohne Rassismus, ohne Sexismus und ohne Ausbeutung. Kriege und Repression erzürnen uns, wir weigern uns mitzumachen und werden sie immer bekämpfen. Das Gedenken an die Genozide ist keine Angelegenheit der betroffenen Völker, sondern muss allen Menschen als Mahnung dienen, insbesondere aber den Tätergesellschaften. Durchbrechen wir das Verschweigen und das Leugnen.
Mit diesem Mahnmal drücken wir, die wir hier anwesend sind, unsere Verbundenheit mit den Nachfahren der Opfer aus und unterstützen vergleichbare Initiativen in unserer Partnerstadt Istanbul.
Die Initiative Völkermord Erinnern hat das Mahnmal den Kölner Bürger*innen geschenkt und der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker heute eine Schenkungsurkunde zugestellt.
Köln, 15.04.2018
Nizaqete Bislimi: Rede im Zuge der Matinee „Völkermorde erinnern – Kriege verhindern“
Rede „Gegen ein leeres Erinnern“ von Nizaqete Bislimi auf der Matinee „Völkermorde erinnern – Kriege verhindern“ am 15.4 2018 im Filmforum NRW im Museum Ludwig
Mein Ur-Großvater hat gegen die Nazis gekämpft. Ich erfuhr davon erst vor kurzem, während der Arbeit an meinem Buch. Bis dahin dachte ich, ich hätte keinen persönlichen Bezug. Meine Mutter erzählte mir während meiner Recherchen, dass ihr Großvater in Jugoslawien gegen die Nazis kämpfte und auch gefallen ist. Also mein Ur-Großvater. Meine Mutter ist in den 50er Jahren geboren, hat diesen Großvater also nicht kennengelernt.
In der Schule lernte ich sehr wenig über den Genozid. In den Geschichtsbüchern wird mit einem Halbsatz erwähnt, das Roma und Sinti ermordet worden. Ich setzte mich also sehr spät erst mit dem Thema auseinander.
Als meine Mutter davon erzählte, war das ein trauriges Gefühl, weil sie nicht und ich auch nicht die Möglichkeit hatten, diesen Menschen kennen zu lernen.
Aber es war auch berührend zu erfahren, dass dieser Mann gegen die Nazis gekämpft hat.
Oft liest man nur von den Opfern, die es gegeben hat. Mein Urgroßvater hat sein Leben gelassen, weil er gekämpft hat, gegen die Nazis. Das war schon sehr berührend.
Die Roma nennen den Genozid Porajmos, was auf deutsch so viel wie »Verschlingen« bedeutet. Wieviele Menschen das betraf und wieviele in nachfolgenden Generationen heute noch betroffen sind, ist unzureichend erforscht. Es wird angenommen, dass 500.000 Menschen ermordet wurden. Diese Zahl ist wie so viele Zahlen in der Politik bis heute umstritten.
Soziale Ausgrenzung, rassistische Diskriminierungen aber auch die zahlreichen und europaweit stattfindenden Vertreibungen, Abschiebungen und sogar Morde an Roma sind keine von einander unabhängigen Einzelereignisse. Sie stehen im Zusammenhang mit einem allgegenwärtigen feindlichen und abwertenden gesellschaftlichen Vorbehalt.
Die Verfolgung durch die Mehrheitsgesellschaft war eine Konstante. Lange vor dem Porajmos. Und auch danach. Mit vielen Abstufungen und Ausprägungen.
In den 50er und 60er Jahren haben die Menschen weitergemacht, die an der Selektion beteiligt waren. Es gab nach wie vor Nazis.
Vielen überlebenden Sinti und ihren Angehörigen wurde kurz nach der Befreiung und nach der Rückkehr aus den Lagern die zuvor aberkannte deutsche Staatsbürgerschaft wieder gegeben. Doch das wurde Anfang der 50er Jahre erneuten Prüfungen unterzogen. Zu großzügig sei man in der Vergabe von Pässen an Überlebende gewesen, fanden die Behörden nun. Dieser rassistische Geiz wirkte auch auf die Praxis der Entschädigungen.
Es dauerte Jahre, bis es zu Entschädigungszahlungen kam. Nach dem Krieg wurden Sinti und Roma von der Bundesrepublik nicht entschädigt, da die Tötungen nicht als Völkermord anerkannt wurden.
Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, hatte anlässlich eines Besuchs beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe im Herbst 2014 darauf hingewiesen, dass sich das Hohe Gericht nach all den Jahren noch immer nicht von diffamierenden Formulierungen eines BGH-Urteils aus dem Jahr 1956 distanziert hatte. Damals hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass Sinti und Roma bis 1943 nicht aus rassistischen Gründen verfolgt worden seien. Die Richter hatten damals argumentiert Sinti und Roma seien nicht aus rassistisch motivierten Gründen von den Nationalsozialisten verfolgt worden, sondern diese Handlungen hätten „polizeiliche Gründe gehabt“. Dies hatte neben der tiefen Beleidigung der Opfer außerdem die Konsequenz, dass an die Überlebenden keine Entschädigungen gezahlt werden mussten. 1963 wurde dieses Urteil revidiert. Erst der Besuch Romani Roses beim Bundesgerichtshof über 50 Jahre später bewirkte eine offizielle Distanzierung dazu.
Im Rahmen eines Besuches in Heidelberg besuchte ich die die Dauerausstellung des Dokumentationszentrums. Die Ausstellung gegen das Vergessen hat mich sehr beeindruckt. Sie ist das Ergebnis einer jahrelangen Bürgerrechtsbewegung.
Der rassistisch motivierte Porajmos wurde erst 1982 durch Bundeskanzler Helmut Schmidt anerkannt. Ausgedacht hatte er sich das nicht selbst, das war kein Geschenk. Die Roma Bürgerrechtsbewegung bestand seit Anfang der 70er Jahre auf ihre Rechte.
In den 60er und 70er Jahren waren viele Roma unter den sogenannten Gastarbeitern. Die sich aber als solche aus Angst vor Ausgrenzung und Diskriminierung nicht zu erkennen gegeben haben. Dieses Verstecken – die Unsichtbarkeit – gibt es bis heute.
Die Kriege im ehemaligen Jugoslawien ab 1993 vertrieben viele Roma nach Westeuropa und auch nach Deutschland.
Kurzfristiger Schutz wurde zumeist über Erlasse und Duldungen geregelt. Duldung bedeutet aber nichts anderes als Aussetzung der Abschiebung,. Eine längerfristige Aufenthaltsperspektive war nicht vorgesehen.
Kaum waren die Kriege vorbei, sollten die geflüchteten Roma abgeschoben werden. Dagegen wehrten sie sich. Und tun es heute noch.
Ob 1991 oder 2002 in Düsseldorf. Oder 2015 in Berlin am Mahnmal.
Diese Kämpfe führten nicht zum Bleiberecht. Doch sie sind als Erinnerung ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben.
Seit 2012 gibt es in Berlin ein Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas. Es wurde in einem langen und schwierigen Prozess erkämpft. Es war für mich nicht glaubwürdig, als Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede zur Einweihung des Mahnmals der im Nationalsozialismus ermordeten Roma und Sinti gedachte. Denn wenige Zeit später löste ihr damaliger Bundesinnenminister Friedrich mit einem großen Interview in einer Zeitung erneut die Debatte über Asylmissbrauch von Roma aus.
Ich spreche mich gegen ein leeres Erinnern und ein kaltes Vergessen aus.
Das war der Grundstein für die Konstruktion der sicheren Herkunftsstaaten Serbien, Mazedonien, Bosnien Herzegowina, Montenegro, Albanien und Kosovo.
Seit der Entscheidung für das Gesetz zu den sicheren Herkunftsstaaten sind monatlich hunderte Roma mit Sammelabschiebungen aus Deutschland bedroht und tatsächlich abgeschoben worden. Die nächsten Abschiebungen stehen fest.
Die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im sicheren Herkunftsstaat Kosovo ist für mich ein unauflösbarer Widerspruch. Es zeigt sich ein unmäßiger Wille zur Ignoranz.
Ignoriert wird die Menschenrechtssituation vor Ort. Als Argument verwendbar ist dagegen die hohe Ablehnungsquote in den Asylverfahren, die man selbst produziert hat.
Folge der Einstufung als sichere Herkunftsstaaten sind Schnellverfahren und Unterbringung in Sondereinrichtungen – auf Verladebahnhöfen, im Wald.
Die zynische Prognose einer geringen Bleibeperspektive, der in Paragraphen gegossene Rassismus gegen Roma isoliert Menschen.
Die Not vieler südosteuropäischer Roma ist riesengroß. Das schmerzt.
Heute flüchten manche nach Deutschland. Nach jeder Abschiebung. Erneut. Immer. Wieder. Also nicht neu – sondern eine alte Geschichte: Familienleben in andauernder Migration. Dieses weitestgehend ignorierte Phänomen umfasst und überschattet Generationen, zerreißt Familien. Ihre Geschichte mit Deutschland ist historisch gewachsen. Die Verantwortung des bundesdeutschen Staates ist vielfach. Kein Rückübernahmeabkommen kann an diesem moralischen Fakt etwas ändern.
Alle Roma sind Nachkommen der Opfer des Nationalsozialismus. Unter den Abgeschobenen sind die Nachkommen der Opfer der im Nationalsozialismus ermordeten R und S in der zweiten und dritten Generation.
Wir sprechen uns gegen ein leeres Erinnern und ein kaltes Vergessen aus.
Und wie sieht es in der Realität aus? Die Proteste sind leise. Die Abschiebemaschinerie läuft. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne Rücksicht auf kranke oder traumatisierte Menschen. Kinder werden aus den Schulen geholt in Flugzeuge gepackt.
Was die Statistik schön macht: die freiwillige Rückreise. Doch Menschen mit Abschiebung zu drohen, wenn sie nicht selbstständig ausreisen, hat mit Freiwilligkeit nichts zu tun!
Für uns Erinnern heißt Abschiebungen zu verhindern.
Proteste, Kundgebungen, Demonstrationen, Gedenkveranstaltungen zu organisieren. Unser Wissen zu archivieren. Unsere Geschichte zu schreiben und unsere Rechte zu fordern.
Wir setzen uns ein für das Recht auf ein sicheres Leben für Roma, aber auch andere Minderheiten, die rassistisch aussortiert werden.
Geht diesen Weg mit uns gemeinsam!
Vielen Dank!!
Das Schicksal der europäischen Roma und Sinti während des Holocaust
Rund 500.000 Roma und Sinti wurden während des Holocaust ermordet als Opfer einer rassistischen Verfolgungspolitik deutscher Nazis und ihrer faschistischen Verbündeten. Doch dieser Völkermord ist heute weitgehend unbekannt. Roma und Sinti wurden in Vernichtungslagern getötet und fielen in Zwangsarbeits- und Konzentrationslagern Hunger und Krankheiten zum Opfer. Viele wurden deportiert und als Zwangsarbeiter ausgebeutet, auf Bauernhöfen, auf Baustellen und in der Industrie. Die Überlebenden wurden jahrzehntelang nicht als Opfer nationalsozialistischer Verfolgung anerkannt und erhielten nur geringe oder überhaupt keine Entschädigungszahlungen für ihren verlorenen Besitz. Die Homepage bietet grundlegende Informationen für SchülerInnen / LehrerInnen über den Völkermord an den europäischen Sinti und Roma.
Website: www.romasintigenocide.eu
Doğan Akhanlı: »Heute wollen wir ein Gedicht schreiben«
»Heute wollen wir ein Gedicht schreiben«
Dogan Akhanli
Wenn ich nicht nach Deutschland eingewandert wäre, hätte ich mir wahrscheinlich niemals die Verbindung zwischen eigener Vergangenheit, eigenen Erinnerungen und der Vergangenheit, den Erinnerungen der Kurden, Armenier, Aleviten, Juden und Griechen ins Bewusstsein rücken können. Die Verbindungen und die Unterschiede. Ich hätte weiterhin dem Mythos der Gründung der Türkischen Republik Glauben geschenkt und hätte gezögert, das Massaker an den Armenier als Völkermord zu bezeichnen.
Als ich nach Deutschland kam, hatte ich nicht ein einziges Buch über den Genozid von 1915 gelesen, das nicht auf Lügen basierte. Das Land, in das ich einwanderte, und mein Geburtsland, Deutschland und die Türkei, hatten seit Jahrhunderten freundschaftliche Beziehungen unterhalten. Und die Vergangenheit beider Länder war voller Traumata. Doch trotz der jeweiligen historischen Schuld gab es grundsätzliche Unterschiede zwischen beiden Ländern. Während die Vergangenheitsbewältigung und die Erinnerungsarbeit in Bezug auf die eigene historische Schuld und Verantwortung das zweite, das schöne Gesicht Deutschlands war, beharrte die Türkei nach wie vor darauf, einen der beiden bestuntersuchten, bestdokumentierten Völkermorde dieser Erde, den an den Armeniern, für den sie Verantwortung trug, zu leugnen, und weigerte sich beharrlich, sich diesem historischen Unrecht zu stellen.
Erstmals 1999 wurde, in der Kölner Aufarbeitungsgeschichte, eine Veranstaltungsreihe „Genozid und Gedenken“ zum Thema Völkermord an den Armeniern organisiert. Jeder von uns, die aus der Türkei stammten, kannte mindestens eine Geschichte über Gräueltaten an den Armeniern, hatte sie schon als Kind oder später als junger Mensch oder noch später als Erwachsener gehört. Aber egal ob man Linksradikaler war, Nationalist oder frommer Muslim: es existierte damals eine unausgesprochene Übereinkunft, die für alle galt: Ignorieren, Schweigen, Leugnen, sobald die Vernichtung der Armenier von 1915-1916 zur Sprache kommt. Die Nationalisten und Ultrarechtnationalisten wollten diese Auseinandersetzung torpedieren, indem sie Veranstaltungen zu sprengen versuchten. Doch es gelang ihnen nicht.
Nach der Veranstaltungsreihe „Genozid und Gedenken“ wurde die Idee geboren, im ehemaligen Kölner Gestapogefängnis, dem heutigen NS- Dokumentationszentrum der Stadt, regelmäßig türkischsprachige Führungen anzubieten. In den Führungen wurden Antworten auf Fragen gesucht wie diese: Ist die Holocaust nur eine jüdisch-deutsche Geschichte oder/und auch eine transnationale Geschichte? Ist der Völkermord an den Armeniern für Deutschland eine „fremde“ Geschichte? In der Ausstellung des NS-Dokumentationszentrums gibt es Dokumente, die zeigen, wie sehr die Geschichte des Holocaust auch eine deutsch-türkische ist. Über Salomon Freud zum Beispiel. Er wurde am 24. September 1884 in Konstantinopel geboren und besaß die türkische Staatsangehörigkeit, ebenso wie seine Frau Hedwig und sein Sohn Alfred. Die Familie Freud siedelte nach Deutschland über und wohnte bis 1939 in Köln. Hedwig, Salomon und Alfred Freud wurden am 3. September 1942 zuerst nach Theresienstadt und dann nach Auschwitz deportiert und gelten als „verschollen.“ Ihr Schicksal ist kein Einzelfall. Während der Shoah wurden über 3.000 türkische Bürger in Europa ermordet (Guttstadt 2008).
Ein Exponat in der Dauerausstellung in Köln erzählt uns, dass Adolf Hitler und Franz von Papen am 4. Januar 1933 Gespräche über eine gemeinsame Regierungsbildung in einer Villa führten (Stadtwaldgürtel 35). Franz von Papen war im Ersten Weltkrieg von 1915 bis 1918 Stabschef der 4. Türkischen Armee. Mit dem Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk besuchte er Palästina, ab April 1939 war er Botschafter in Ankara (Gottschlich 2015). Die türkischen Streitkräfte im Ersten Weltkrieg standen weitgehend unter deutschem Oberbefehl. Zum Beispiel unter dem von General Otto Liman von Sanders, der im „Prozess Talaat Pascha“ als Sachverständiger auftrat (Hofmann 1980). Die wahren Täter des Völkermords (unter ihnen Talat, Enver und Cemal Paşa) flohen mithilfe der Deutschen nach Berlin. In dem Jahr, in dem ein junger Mann namens Raphael Lemkin mit dem Jurastudium begann, wurde der Hauptverantwortliche der Armenier-Deportationen, Unterzeichner der Deportationsbefehle, Innenminister und Großwesir Talat Paşa, am 15 März 1921 in der Hardenbergstraße in Berlin von Soghomon Tehlirian erschossen.
Lemkins späterer Kommentar zu diesem Ereignis war: „Der Talat-Paşa-Prozess von 1921 war sehr lehrreich. Ein Mann, dessen Mutter beim Völkermord getötet wurde, Soghomon Tehlirian, tötet Talat Paşa. Sehen Sie, als Rechtsanwalt habe ich gedacht, dass ein Vergehen nicht durch das Opfer, sondern durch ein Gericht, durch nationale Justiz bestraft werden müsste.“ Den Einfluss des Völkermords an den Armeniern auf die Formulierung der Völkermordkonvention beschreibt Lemkin folgendermaßen: „Das Leid der armenischen Männer, Frauen und Kinder, die in den Euphrat geworfen oder auf dem Weg nach Deir ez-Zor massakriert wurden, war der Wegbereiter zur Annahme der ‚Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes‘.“
Raphael Lemkin verlor als schwuler Jurist alle Angehörigen (mit Ausnahme seines Bruders und seiner Schwägerin) im Holocaust. Er starb 1959, völlig verarmt, in New York. Auf seinem Grabstein steht: Father of the Genocide Convention.
In der 256 Seiten umfassenden Urteilsschrift der Nürnberger Prozesse, bei denen die Hauptkriegsverbrecher des Nazi-Regimes vor Gericht gestellt wurden, sind der Vernichtung der europäischen Juden lediglich drei Seiten gewidmet. Der Begriff Völkermord wird in der Anklageschrift dieses Prozesses erstmalig verwendet. Es ist das erste offizielle Dokument, in dem erwähnt wird, dass es sich bei dem Völkermord an den Armeniern um „den ersten Genozid des Jahrhunderts (handelt), bei dem 1,4 Millionen christliche Armenier auf Befehl der türkischen Regierung getötet wurden“.
Trotz der unverzeihlichen Schwächen der Sicherheitsbehörden, die die NSU-Morde sowie ähnliche Übergriffe und Anschläge nicht verhindern konnten, hat die heutige Erinnerungskultur Deutschlands nicht nur für das Land selbst, sondern auch auf internationaler Ebene große Bedeutung. Die NSU-Morde sind gleichzeitig auch eine bittere Warnung, nicht zu vergessen, dass Erinnerungskultur nicht statisch ist, sondern ein Prozess, in dessen Verlauf jede Generation ihre Art, ihre Mittel der Geschichtsaufarbeitung immer wieder überdenken und weiterentwickeln muss.
Die Geschichtsaufarbeitung der Türkei ist eine Erfahrung der Leugnung, die eine wissenschaftliche Untersuchung wert wäre.
“Es giebt andererseits auch sehr wenig Türken,“ schrieb der Korrespondent der „Kölnischen Zeitung“ (Tyszka ) am 15.9.1915, „mit denen man offen über die Armenierfrage reden kann, gleich bricht selbst bei sonst gebildeten und weltgewandten Menschen eine Wut durch, die alles in einen Topf wirft und die immer mit dem Refrain endet: „Alle Armenier gehören ausgerottet, sie sind Verräter!“ [Dokumente aus dem Politischen Archiv des deutschen Auswärtigen Amts / “1915-09-05-DE-001/Quelle: PA-AA/R 14087; A 27887, pr. 24.9.1915 p.m.;]
Der Hass, der immer noch aktuell ist, mit dem in der Türkei nicht-türkischen, nicht-muslimischen Mitbürgern begegnet wird, erinnert an die Worte des israelischen Psychoanalytikers Zvi Rix: Auschwitz werden uns die Deutschen niemals verzeihen! Denn die Juden waren lebende Beweise des Geschehenen, die die Deutschen ständig an ihre Schuld erinnerten. Mit hoher Sensibilität wurde Verantwortung übernommen, wurden wichtige Maßnahmen ergriffen, Mittel und Wege zur Wiedergutmachung zu finden und auf Opfer und Überlebende des Holocausts zuzugehen. Währenddessen beharren diejenigen, die die türkische Identität überbewerten, seit hundert Jahren darauf, den Armeniern das Konzentrationslager Deir ez-Zor, das 1915/16 in der syrischen Wüste eingerichtet war, niemals zu verzeihen. Diese Herzensblindheit, vermengt mit dem Schlamm aus Leugnung und Lügen, produziert Mörder. Weil die größte Schuld unserer modernen Geschichte nicht aufgearbeitet wurde, weil kein Weg gefunden wurde, mit der Schuld umzugehen, bleiben nicht nur der Staat mit seinen Institutionen, sondern auch die Gesellschaft zu Gewalt und Mord verdammt. Vor unsert Augen wurde Hrant Dink erschossen, wurde der Mörder als Held gefeiert, ließen sich Polizisten mit ihm neben der türkischen Flagge fotografieren, feierten sie den Mord mit dem Absingen der Nationalhymne. In Malatya wurden Mitarbeiter einer Bibel-Druckerei abgeschlachtet, in Trabzon wurde ein italienischer Mönch ermordet. Selbst nach dem Tod von 50 000 Menschen wurden den Kurden die grundlegendsten Rechte vorenthalten. Die Wüste von Deir ez-Zor hörte nach einem Jahrhundert nicht auf, Menschen, nun auch andere Ethnien, zu schlucken.
Es war politisch und moralisch nicht hinnehmbar, dass Deutschland, trotz der Erfahrung der Geschichtsaufarbeitung, die Anerkennung des Völkermordes an den Armeniern bis ins Jahr 2016 hinausgezögert hat.
Es ist soweit.
Den Holocaust in Verbindung mit dem Völkermord an den Armeniern zu betrachten, bedeutete heute keine Relativierung der Schoah, sondern eine Erweiterung und Vertiefung der deutschen Aufarbeitung, die aber nicht mehr nur deutsch bleiben sollte. Denn die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts, des Jahrhunderts der Völkermorde, sollte Teil der Holocaust Education sein, und die Beschäftigung damit sollte aus dem nationalen Rahmen in einen transnationalen übertragen werden. Auschwitz verwandelte den Versuch, weiterhin Gedichte zu schreiben, zwar in Barbarei (wie Adorno sagte), aber der einzige Weg, die Existenz von Auschwitz zu ertragen und sich zur Wehr zu setzten, besteht darin, trotz Auschwitz Gedichte zu schreiben.
Und heute wollen wir ein Gedicht schreiben. Das ist der Sinn der Veranstaltung.
Über den Sinn der Matinee „Dieser Schmerz betrifft uns alle“
Matinee „Dieser Schmerz betrifft uns alle. Völkermorde erinnern, Kriege verhindern“
(Albrecht Kieser, Moderator)
Warum haben wir hierher eingeladen? Weil wir uns Sorgen machen. Weil wir den Eindruck haben, dass Deutschland an einer Scheidelinie steht.
Rassismus und Nationalismus werden wieder in beängstigendem Maße hoffähig. Große Teile der etablierten Politik lassen sich von der rechtsradikalen AfD antreiben und wenn Seehofer sich zum Vorkämpfer gegen Muslime in Deutschland stilisiert, dann ist das nur die Spitze des Eisberges.
Rassismus und Nationalismus sind Geisseln der Menschheit, Peitschen also, Plagen. Wir erleben auch in anderen Ländern täglich, wie diese Geisseln zielbewusst eingesetzt werden: Zur Stabilisierung maroder Herrschaftsapparate wie in den Vereinigten Staaten des Donald Trump, zur Rechtfertigung imperialer Kriegsmaßnahmen wie in Erdogans Reich oder zur Legitimierung flüchtlingsfeindlicher Innenpolitik, nicht nur von Ungarns Orban.
Sondern eben auch in Deutschland. Die Ihnen wahrscheinlich bekannte „Gemeinsame Erklärung 2018“ aus dem rechten bis rechtsradikalen Milieu sammelt hinter zwei Sätzen Leute wie Henryk M. Broder, Uwe Tellkamp, Thilo Sarrazin, Bassam Tibi oder Vera Lengsfeld und gut 100.000 weitere Unterzeichnerinnen und Unterzeichner.
Diese Leute wollen mit ihren zwei Sätzen einen Sturm entfachen, der hinweg fegen soll, was ihnen nicht passt: Flüchtlinge. Die Sätze lauten: „Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird.“
Nichts davon stimmt. Im Gegenteil: Die deutschen Grenzen sind spätestens seit dem Herbst 2015 wieder mörderisch dicht. Illegale Masseneinwanderung findet in keiner Weise statt, nicht einmal legale gibt es noch. Und beschädigt wurde im Sommer 2015 bestenfalls die Illusion, Deutschland sei unschuldig an den Ursachen weltweiter Migration und könne sich in ein nationales Wolkenkuckucksheim davon stehlen.
Die zwei Sätze der „Erklärung 2018“ offenbaren die Kernmethode von Rassisten und Nationalisten: die Realität durch verbale Pyrotechnik vernebeln und die Geschichte der grausigen Folgen ihrer altbackenen politischen Vorschläge mit denselben Mitteln unkenntlich machen.
Als wir die Matinee konzipiert haben, lag diese Erklärung noch nicht vor. Und obwohl sie sich scheinbar einem anderen Thema widmet als dem unsrigen, ist der Zusammenhang doch offensichtlich. Dieselben Kreise, die diese Erklärung produziert haben, fordern – Zitat – „eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ und verlangen ein Ende des von ihnen so genannten „Schuld-Kultes“.
Was wirklich Angst macht: das ideologische Zusammenspiel von Rassisten, Nationalisten und Geschichtsleugnern ist nicht auf rechtsradikale Kreise beschränkt. Im niedersächsischen Bergen hat der Stadtrat ein jahrelang vorbereitetes Kooperationsprojekt mit der Gedenkstätte Bergen-Belsen im November 2017 mit den Stimmen von CDU und Grünen abgelehnt. Der Geschäftsführer des Stiftungsrates der Stiftungen Niedersächsischer Gedenkstätten Jens-Christian Wagner sagt dazu, ich zitierte: „Die Stadträte…waren mehrheitlich recht jung. Keiner von ihnen leugnet die NS-Verbrechen. Trotzdem hat sich etwas verschoben: Das Bewusstsein, dass die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen grundlegend ist für unser demokratisches Selbstverständnis; dieses Bewusstsein und damit das Gefühl der Verantwortung schwinden – weit über die AfD hinaus.“
Wer zurück will zu einem starken völkischen Staat, muss nicht nur alles „Volksfremde“ ausmerzen. Er muss auch die Geschichte seines Staates von dessen offensichtlichen Verbrechen reinigen. Der Historiker Volker Weiß sagte dazu kürzlich: „Die eigene Nationalgeschichte soll als glorreiche Geschichte ohne Makel und ohne Schatten erinnert werden.“
Zu den grausamsten staatlichen Verbrechen Deutschlands gehören die Genozide an seinen vermeintlichen, tatsächlichen oder erklärten Gegnern. Deshalb wollen völkische Nationalisten die Genozide, die unter deutscher Führung oder deutscher Mithilfe verübt wurden, aus der lebendigen Erinnerung herausdrängen.
Wir wollen das Gegenteil.
Wir wollen eine staatskritische Erinnerungskultur erhalten und ausweiten. Auch weil wir glauben, dass das Wissen über die Geschichte der genozidalen Folgen von Rassismus und Nationalismus hilft, rassistische Ausgrenzungen in der Gegenwart besser zu erkennen und sie zu bekämpfen und nationalistische Mobilmachungen für Kriege zu behindern.
Presseerklärung: „Dieser Schmerz betrifft uns alle – Völkermorde erinnern, Kriege verhindern“
Matinee „Dieser Schmerz betrifft uns alle. Völkermorde erinnern, Kriege verhindern“
15. April 2018, 11.00 Uhr, Filmforum NRW, Köln
Alte und neue Nationalisten betreiben mit großer Energie eine erinnerungspolitische Wende, um das Gedenken an deutsche Menschheitsverbrechen zu löschen.
Die Veranstaltung „Völkermorde erinnern – Kriege verhindern“ am 15.4. um 11 Uhr im Filmforum NRW Köln (Museum Ludwig) stellt sich gegen die Rückkehr zu verlogenen Geschichtsbildern.
Denn wo heute in Europa die staatskritische Erinnerungskultur ins Abseits gedrängt wird, blüht der aggressive und völkische Nationalismus auf.
Wir sprechen auf dieser Veranstaltung vom Wert und von der Unverzichtbarkeit einer kritischen Erinnerung an die genozidalen Folgen von Rassismus und Nationalismus, weil wir auch für gegenwärtiges staatliches Unrecht wach und mit dessen heutigen Opfern empathisch bleiben wollen.
Auf der Matinee werden Filmausschnitte von Aghet (Eric Friedler), Skulls of my people (Vincent Moloi) und A people uncounted (Aaron Yeger) gezeigt.
Redebeiträge für das Erinnern und gegen das Verschweigen halten Israel Kaunatjike (Namibia-Aktivist, zum Völkermord an OvaHerero und Nama), Dogan Akhanli (Schriftsteller, zum Völkermord an den Armeniern), Peter Finkelgruen (Schriftsteller und Autor, zur Shoah) und Nizaqete Bislimi (Vorsitzende des BundesRoma-Verband e.V., zum Genozid an den Roma und Sinti).
Musikalisch gerahmt wird die Matinee durch Beiträge des kurdischen Gitarrenduos Meral & Evin.
Veranstalter: Initiative Völkermord Erinnern; recherche international e.V., FilmInitiativ Köln e.V.
Unterstützt von: Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V., Kulturforum TürkeiDeutschland e.V., Jugendclub Courage e.V., Anerkennung Jetzt!
www.voelkermord-erinnern.de;
Wir bitten freundlich um Berichterstattung.